Mein Heimatdialekt, das Mayener Platt, ist wohl einer der auffälligsten Dialekte im deutschen Sprachraum und von Begebenheiten, die das bestätigen, kann bestimmt jeder Mayener erzählen. Sei es, dass er bloß nicht verstanden wird oder dass z. B. ésch jinn, dau jahs, e jaht, mir jinn für chinesisch gehalten wird. Mayener Platt ist in seinem Klang weit von der Standardsprache entfernt. Und auch sein spezieller Wortschatz hat einiges zu bieten. Daher entstand allmählich der Plan, den Dialekt festzuhalten. Aber um „Et wòòremòòl ...“, um unterhaltsame Geschichten aus der „alten Zeit“, ging es mir nicht. Wer das erwartet hat, wird sich getäuscht sehen. Vielmehr war das Ziel, nicht nur den gesamten Mayener Wortschatz zu dokumentieren, sondern auch die lautlichen Besonderheiten sowie die grammatischen Unterschiede des Dialekts zur Standardsprache (Formen und Gebrauch) anhand der Wortarten mit zahlreichen Beispielen systematisch und detailliert zu beschreiben. Damit nicht genug, will das Mayener Wörterbuch auch Materialquelle für die Dialektologie sein. Deshalb wurden die Stichwörter nicht nur in Populärumschrift, sondern zusätzlich in das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) transkribiert.
Die Sammlung des Wortschatzes, bei der die eigene Sammlung - aus dem Gedächtnis aufgeschriebene Mayener Wörter,
Ausdrücke, Redensarten usw., die zunehmend außer Gebrauch geraten sind, sowie von der Standardsprache
abweichende grammatische Formen - den Anfang gemacht hat, geschah mit Hilfe einer Datenbank. Aus verschiedenen
Mundartwörterbüchern, die moselfränkische Dialekte beschreiben, wurden weitere auch im Mayener Platt vorkommende
Wörter herausgesucht und in die Datenbank eingegeben.
Dazu gehören auch REINHOLD SPITZLEIs Bücher
„Mayener Schimpfwörter“ (1993) und „Mayener Fransüsesch“ (1994) sowie das unveröffentlichte Manuskript (Archiv
des GAV Mayen) seiner Wortsammlung zum Mayener Wortschatz (2013)
. Sie wurden berücksichtigt und eingearbeitet.
Im Wörterbuchteil sind die bei SPITZLEI gefundenen Stichwörter mit zwei Sternchen (**) kenntlich gemacht.
Auch die kleine Sammlung Mayener Wörter von WALTER FISCHER
(in Kurrentschrift), die sich im Archiv des
Geschichts- und Altertumsvereins Mayen befindet (Findebuch Nr.187) mit dem Titel: „[H]s. [handschriftliches;
G. D.-S.] Wörterbuch mit Verzeichnis des Mayener Sprachschatzes und dessen hochdeutsche Übertragung“, wurde von
mir komplett durchgearbeitet und die darin noch gefundenen Wörter eingearbeitet. Meine Übertragung der Wörter in
die Standardsprache folgt dem originalen Notizbüchlein von WALTER FISCHER und weicht teilweise von derjenigen
der Mundartinitiative (siehe Kapitel 20) ab. Im Wörterbuchteil sind die Wörter aus WALTER FISCHERs Sammlung mit einem Sternchen (*)
hinter dem Stichwort gekennzeichnet. Als wertvolle Quellen erwiesen sich auch die „Liedtexte in Mayener Mundart“
von den „Spatzen“, da sie nicht nur Beispiele, sondern sogar Belege für heute nicht mehr bekannte Formen liefern
, z. B. der Faasenaacht. Dasselbe gilt für die Mundartlieder in „Die Stadt Mayen mit ihren Jahrtausenden“, z. B.
„Kohmt [sic!] nämlech Faasenaacht“.
Die hauptsächliche Datengrundlage war aber das RHEINISCHE WÖRTERBUCH, ein neunbändiges großlandschaftliches
Wörterbuch, das online verfügbar ist
. Aus ihm wurden, was wörtlich zu nehmen ist, von A bis Z sämtliche
(mir bekannten) Mayener Wörter herausgesucht und in die Datenbank eingepflegt. Diese umfasst nun gut 9000
Stichwörter. Um das Wörterbuch nicht nur lesbar, sondern auch hörbar zu machen, wurden (fast) sämtliche Einträge
(Stichwörter und Beispiele) von mir gesprochen. Durch anklicken des Lautsprechersymbols können sie abgehört
werden.
Vielleicht lässt sich der eine oder andere Mayener, darauf ein, zu erfahren, wie es kommt, dass sein Platt so aus
andern Dialekten heraussticht. Derjenige, der sich ausführlicher mit dem Platt beschäftigen will, findet in
Kapitel 20 mehr dazu.
An dieser Stelle sei allen, die mich mit meinem Projekt unterstützt haben, ein herzliches „Dankeschön!“ gesagt. An erster Stelle danke ich meinem lieben Mann, Jürgen Schmidt, der all die vielen Jahre mein Projekt live erlebt , mitgelebt und mit erlitten hat. Er hat angeregt, meine Sammlung „lustiger“ Mayener Wörter zum Wörterbuch auszubauen. Er hat mein Projekt von Anfang bis Ende begleitet. Dafür danke ich ihm ebenso wie für die wissenschaftliche Beratung, unzählbare (nicht immer einfache) Diskussionen, für jegliche Hilfe beim Überwinden etlicher Schwierigkeiten in Rat und Tat, nie nachlassende Bereitschaft, sich mit meinem Projekt zu befassen, für das Bestärken im Fortsetzen und zum Durchhalten bis zum Schluss, und, und, und.... Dafür danke ich ihm von Herzen.
Ebenfalls gilt mein ganz besonders herzlicher Dank meinem Schwiegersohn Ingo Schmidt, der sich liebenswürdigerweise sofort erboten hat, aus der Datenbank die Online Version zu erstellen und diese Mammutaufgabe in seiner nicht vorhandenen Freizeit bewältigt hat, wobei wohl besonders die Sprachaufnahmen schwierig waren. Ich danke ihm sehr dafür, dass er jede Menge seiner freien Zeit für mich geopfert hat!
Der Dank an meine Freundin Margret Kirst für ihren begeisterten Einsatz beim Wörtersammeln („Hast du das schon?“) , für die Diskussionen mit ihr, die oft eher Debatten waren, und Telefoninterviews zum Mayener Platt kann sie nicht mehr erreichen, da sie im September 2016 plötzlich verstorben ist.
Ein großer Vorteil war, dass mich eine Reihe von Wissenschaftlern des Marburger Forschungszentrums „Deutscher Sprachatlas“ technisch unterstützt haben. So hat Herr Jost Nickel, der inzwischen leider verstorben ist, die Datenbank für mein Projekt eingerichtet, Robert Engsterhold hat sie aktualisiert und bei den verschiedendsten Computerproblemen geholfen, Dennis Beitel hat die Aufnahmetechnik eingerichtet und betreut.
Ebenfalls danke ich Herrn Hans Schüller vom Geschichts- und Altertumsverein Mayen, dafür, dass er mir WALTER FISCHERS „[H]s. [handschriftliches; G. D.-S.] Wörterbuch mit Verzeichnis des Mayener Sprachschatzes und dessen hochdeutsche Übertragung“ als Kopie hat zukommen lassen ebenso wie die 2013 noch unveröffentlichte Wörtersammlung von REINHOLD SPITZLEI, und besonders auch für die Genehmigung des Fotos unserer Lok.
Herrn Dr. Karl Hausmann, der im August 2018 verstorben ist, verdanke ich die Zusendung der kleinen Schrift von JOSEF HILGER - einer kurzen Darstellung der Mayener Grammatik.
- U. a. sind dies BESSE (2004), CLEMENS (2013), SCHMIDT (Reprint/Nachdruck1982 /1800). ↩
- Inzwischen (2019) vom Geschichts- & Altertumsverein für Mayen und Umgebung e.V. herausgegeben: SPITZLEI REINHOLD: Mayener Wortschatz 1.0. Eine Sammlung der Mayener Mundart. ↩
- 2018 wurde es veröffentlicht unter dem Titel: FISCHER, WALTER: Offjeschriewe. Wöata, Red on Sprüch en da Mayener Sprooch. (Hrsg: Geschichts-& Altertumsverein für Mayen und Umgebung e.V. Mundartinitiative). Vgl. zu den genannten Titeln Kapitel 20 und das Literaturverzeichnis. ↩
- SCHÄFER 1998, 113, und GEIERMANN 1978, 349 (Autor nicht feststellbar). ↩
- Vgl. hierzu Kapitel 20 und das Literaturverzeichnis. ↩
- Zum Gebrauch des Wörterbuchs siehe Kapitel 18. ↩
1. Einordnung des Dialekts
Dorf, dat, Pónd, Abbel. Die Einordnung des Mayener Platts in die Dialektlandschaft
Wenn der Mayener in der Fremde den Mund aufmacht, wird er mit schöner Regelmäßigkeit alsbald gefragt: „Kommen Sie aus Köln?“ - und das, obwohl er „Hochdeutsch“ spricht. Der Mayener ist über die Zuordnung meist verwundert, denn für ihn liegen zwischen seiner Sprache und dem Kölschen Welten. Dennoch gibt es für diese Zuordnung einen triftigen Grund: Das auffälligste Merkmal seiner Sprechweise hat der Mayener mit dem Kölner gemeinsam: Es ist die besondere Sprachmelodie, der „Rheinische Singsang“, das „Rheinische Singen“ oder die „Rheinische Akzentuierung“. Die nicht zu überhörenden Gemeinsamkeiten mit dem Kölschen mögen ein Grund dafür sein, dass Mayen, das „Tor zur Eifel“ - ca. 25km beträgt die Entfernung zum Nürburgring, ca. 20km zum Rhein (Andernach) und ca. 20km zur Mosel (Hatzenport) – seit jeher nach Köln hin orientiert ist - besonders auch, was das Fas(t)nachtfeiern angeht - und nicht etwa zur Landeshauptstadt Mainz. Die Klänge des rheinfränkischen Mainzer Dialekts sind dem Mayener eben nicht vertraut. Wegen dieser sprachlichen Gemeinsamkeiten des Mayener Platts mit dem Kölschen werden beide Dialekte zur selben Gruppe, dem Historischen Westdeutschen oder Rheinischen (vgl. SCHMIDT / MÖLLER 2019), traditionell: dem Mittelfränkischen, gezählt, in dem es diese sogenannten Tonakzente exklusiv, also einzig und allein im gesamten deutschsprachigen Raum gibt . Wegen der ebenso klaren Unterschiede zwischen beiden Dialekten gehören sie aber verschiedenen Untergruppen an: das Kölsche der ripuarischen und das Mayener Platt der moselfränkischen, wie die folgenden beiden Karten zeigen:
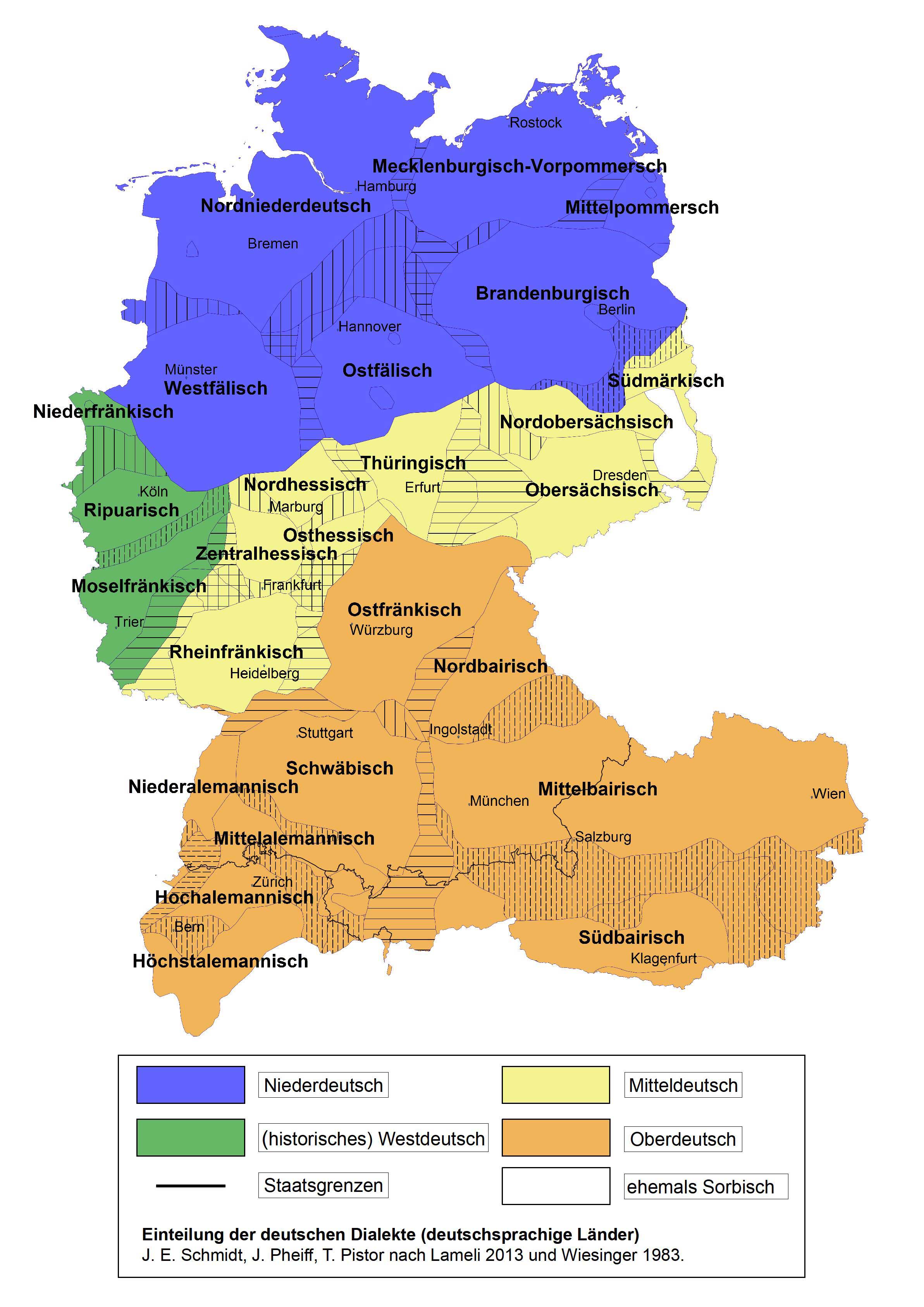
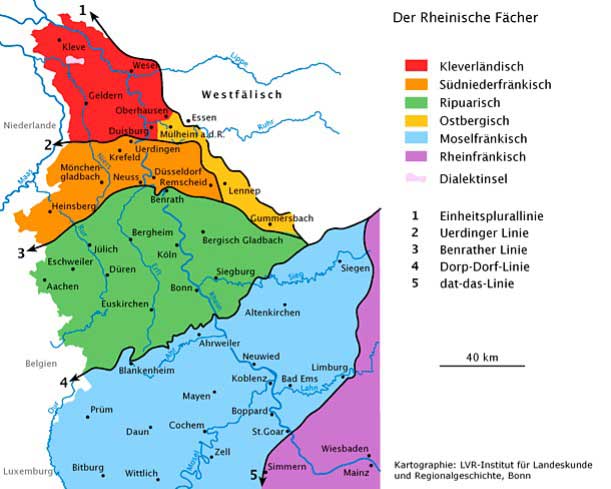
Für die Gruppierung der rheinischen Dialekte wird traditionell der „Rheinischen Fächer“ herangezogen, der sich –
geographisch gesehen - vom westlichen Rheinland bis zum Rothaargebirge erstreckt. Seine verschiedenen
Dialekträume sind das Ergebnis der zweiten (oder: hochdeutschen) Lautverschiebung, jener sprachlichen
Entwicklung, durch die sich das Deutsche von eng verwandten germanischen Sprachen Englisch, Niederländisch und
Friesisch unterscheidet. Diese Lautverschiebung dürfte zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert n. Chr. erfolgt sein.
Die Laute, die verschoben wurden, betreffen den Konsonantismus /die Mitlaute. Die Konsonanten p, t, k wurden
abhängig von ihrer Position im Wort zu (p)f, (t)s, (k)ch verschoben: Altsächsisches slāpan wurde zu
althochdeutsch slāfan (schlafen), asächs. strāta zu ahd. strāzza (Straße) und asächs. rīki wurde zu ahd.
rīhhi (reich).
Im Rheinland wurde die 2. Lautverschiebung nur unvollständig – von Süden nach Norden abnehmend
- durchgeführt, was zu einer sprachlichen Staffellandschaft führte. Diese „Auffächerung“ der Lautverschiebung
hat sich bis heute im Wesentlichen erhalten und wird zur Dialektgliederung verwendet, wozu man bestimmte
Kennwörter heranzieht:
Nördliches unverschobenenes ik gegen südlicheres verschobenes ich bildet Linie 2 (= Ürdinger Linie), nördliches
unverschobenes maken gegenüber südlichem machen bildet Linie 3 (= Benrather Linie), unverschobenes Dorp gegen
verschobenes Dorf bildet Linie 4, unverschobenes dat gegen südliches das die Linie 5. Zwischen der
Dorp/Dorf-Linie (4), an die sich nach Norden das Ripuarische (= Kölner Sprachraum) anschließt, und der
südlicheren dat/das-Linie (5) liegt das moselfränkische Gebiet, das sich bis nach Luxemburg fortsetzt.
- Zu Ursache, Bedeutung und Funktion der Tonakzente siehe unten, Kapitel 7. ↩
- Vergleichbare Tonakzente gibt es sonst im Norwegischen und Schwedischen und in Tonsprachen wie z. B. im Chinesischen. ↩
- Vgl. zum Rheinischen Fächer auch OLBERT 1991, 51-55. ↩
- Bei einer Unterteilung in nördliches und südliches Moselfränkisch, gehört Mayen zum südlichen mit der Kennform of für ‘auf‘ im Gegensatz zu op. Vgl. hierzu Kapitel 3. ↩
2. Besonderheiten des Klangs
Staan ón Baan, Äis ón Wäin, Wuascht ón Duascht. Wie anders klingt Mayener Platt?
Vom Moselfränkischen heißt es: „Moselfränkisch unterscheidet sich deutlich von den übrigen deutschen Mundarten.“
Ein Beitrag der Deutschen Welle aus dem Jahr 2009 nennt „den moselfränkischen Dialekt einen ‚Exoten‘ unter den
deutschen Dialekten, die Sprache an der Mosel klinge bunt, wild und ganz anders. Im Gegensatz dazu beschreibt
ein Reisebuch aus dem Jahre 1840 das Moselfränkische in der Stadt Trier so: ‚Die Sprache hat in ihrer
volltönenden Breite etwas ungemein treuherziges und gemüthliches‘. In der Tat wird Moselfränkisch von anderen
Deutschsprechenden außerhalb der moselfränkischen Sprachgruppe nur schwer oder überhaupt nicht verstanden.“
Zweifellos entsteht einerseits der Eindruck des Gemütlichen wegen des erwähnten Rheinischen Singens
und der
Eindurck des Bunten, Wilden andererseits durch vielen klanglichen Differenzen zu den übrigen Dialekten und zur
Standardsprache
. Dies gilt in ganz besonderem Maße für das Mayener Platt. Dass man speziell Mayener mit ihrem
auch unter den moselfränkischen Dialekten auffallenden Platt besonders gut aus einer Gruppe heraushört, mag die
folgende Anekdote belegen: „Ihre Lärmigkeit, zusammen mit ihrer Mundart, sind auch der Grund, daß man die
Mayener selbst in den unwahrscheinlichsten Situationen, etwa auf einem fernen Eiland oder in tiefster
nächtlicher Dunkelheit, sofort als Mayener erkennt. Überall bekannt war während der beiden letzten Weltkriege
(vielleicht auch schon in früheren Feldzügen) die Tatsache, daß man aus einer fremden Marschkolonne den Mayener
jederzeit deutlich als solchen heraushört. Und viel erzählt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch der Witz,
bei dem ein russischer Soldat einem in russische Gefangenschaft geratenen Mayener die ordenübersäte Brust
abräumt, der Mayener ihm schließlich die bekannte Mayener Anrede: ‘[Dau] schwera Nickelooß!‘ entgegenbrummt,
und der Russe darauf freudestrahlend mit den Worten: ‚Du Mayen, du Mayen!‘ diesem all seine Orden wieder
zurückgibt.“
Dass das Mayener Platt auch unter den moselfränkischen Dialekten, die ebenfalls „singen“, noch heraussticht,
liegt nicht zuletzt an seinen zusätzlichen Vokalen sowie ihrer Verteilung, besonders aber am a [ɑ]. Durch sein
auch im Vergleich zu den umgebenden Dialekten ungewöhnlich häufiges Vorkommen und seine „Breite“ ist das a der
auffälligste der Mayener Vokale. Dieses typische Erkennungszeichen des Mayener Platts entlarvt den Mayener als
solchen. Wo in umgebenden Dialekten ein schwachtoniges e [ə] (Mennejen, Annenache, Krööfde usw.) und in der
Standardsprache ein angedeutetes a [ɛɐ] (Mendiger, Andernacher, Krufter) zu hören ist, realisiert der Mayener
ein volltönendes a [ɑ]: Mennéja, Annanacha, Krufda. Der Mayener vazéllt ón zaschlaat, jaht ón staht ón waaß
Beschaad. Das ‘a‘ provoziert spöttelnde Aufforderungen (Leevje sòò aas Klaadaschrank! ‘Liebchen sag‘ mal:
Kleiderschrank!‘oder Lääwawuascht! ‘Leberwurst!‘ oder Läädatösch! ‘Ledertasche!‘) und im NIEDERMENDIGER
WÖRTERBUCH heißt es für Mayen neben dem „Duudschlaajer, die: Mayener-Totschläger [...]“ als Ortsneckname „Auch
‚Klaa Paris‘. Die Mayener Mundart nachahmend.“
. Ein bekannter Mayener Spruch zum ‘a‘ ist ein weiterer Beleg:
Daat dat dat? Dat dat dat daat! Dat daat dat! ‘Tut sie (wörtl. das) das? Dass sie das tut! Das tut sie!‘ Oder
auch: Darf dat dat? ‘Darf sie das?‘
Auch das Mayener ‘r‘ wird in den standardsprachlichen Lautkombinationen e+r, i+r, o+r, u+r, ä+r, ö+r, ü+r zu
einem vollen a [ɑ], d. h., es werden zwei Vokale (Doppellaute) gesprochen: Bei e+r heißt es Kéaz ‘Kerze‘, bei
i+r Wiat ‘Wirt‘, wüad ‘wird‘, Bia ‘Birne‘, Kiaschbel ‘Kirchspiel‘ (veraltet /ausgestorben?), Küasch ‘Kirsche,
Küaje ‘Kirschen‘, bei o+r Hoa ‘Horn‘, Koa ‘Korn‘, Woat ‘Wort‘, bei u+r Wuascht ‘Wurst‘, Duascht ‘Durst‘,
Kuascht ‘Kruste‘, bei ä+r J`öatner ‘Gärtner‘, B`öat ‘Bärte‘, K`öatsche ‘Kärtchen‘, bei ö+r Pöatsche ‚‘Pförtchen,
kleine Pforte‘, bei ü+r Schüaz ‘Schürze‘, Düa ‘Tür‘ und Büascht ‘Bürste‘. Dabei liegt die Betonung jeweils auf
dem vorderen Vokal.
Selbst das ‘ei‘ der hochdeutschen Standardsprache wird in Abhängigkeit von der mittelhochdeutschen Form des
entsprechenden Wortes zum /a/. So heißt es z. B. Baan und Staan ‘Bein‘ und ‘Stein‘, allaan ‘allein‘, Laader
‘Leiter‘, praat ‘breit‘, raase ‘reisen‘. Als /äi/ [ɛi] erscheint dagegen das hochdeutsche /ai/ z. B. in Äis
‘Eis‘, Päin ‚Pein‘, Wäin ‘Wein’ und auch als /ai/ [ai] kommt es vor z. B. in Fleisch ‘Fleisch‘, Deisch ‘Teich‘,
heiß ‘heiß‘ und Ei ‘Ei‘. Diese drei Varianten des ‘ei‘ sind mit dem jeweiligen Wort verbunden und nicht
gegeneinander austauschbar – was Mayener-Platt-Lernen oder Mayener-Platt-Verstehen nicht leichter macht.
Deshalb sind diese ei-Laute sogar zur Feststellung der Dialektkompetenz geeignet.
Auch die Längen und Kürzen
von Vokalen sind nicht selten anders verteilt als in der Standardsprache. So heißt es z. B. nicht ‘essen‘,
nicht ‘wohnen‘, nicht ‘kalt‘ und nicht ‘holen‘, sondern ääse, wónne, kaal und hólle: E hat sésch en kaal Naas
jehóllt. ‘Er hat sich eine Abfuhr geholt.‘
- Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Moselfr%C3%A4nkische Dialekte. ↩
- Vgl. Kapitel 7. ↩
- Zu den Mayener Vokalen im Einzelnen siehe unten Kapitel 6. ↩
- KREMER 1992, 111. ↩
- CLEMENS 2013, 337. In Mayen heißt es: Duut-schlääja. ↩
- Die hier gewählten Schreibungen finden sich im Wörterbuchteil nur in Ausnahmefällen. Die Populärumschrift im Wörterbuchteil orientiert sich der besseren Lesbarkeit willen näher an der normalen Rechtschreibung, da die Wörter zusätzlich in IPA notiert sind und man sie sich auch anhören kann. ↩
- Alle Realisierungen und alle lautlichen Besonderheiten des Mayener Platts darzustellen, sprengt den hier gewählten Rahmen. ↩
3. Konsonanten
Jaaß, Jans, Jalje, Jeld, Klobus, Knaad, Kluck, Krósche und Deer, Daach, deef, Düür. Einiges zu den Mayener Konsonanten / Mitlauten
Für das Mayener Platt ist der Gebrauch von j anstelle von standardsprachlichem g typisch: Es heißt Jaaß, Jans,
Jaar, Jel´öck, Jeh´öschnis (‘Geiß‘, ‘Gans‘, ‘Garn‘, ‘Glück‘, ‘Gehäugnis‘). Doch wenn man et óf goot Jel´öck
nachzuahmen versucht, geht das leicht schief – es heißt nicht *joot und nicht *Jaby, sondern goot und Gaby!
Komplizierter wird es noch dadurch, dass außer j und g auch noch k für standardsprachliches g vorkommt: Es heißt
im Mayener Platt bekugge ‘begucken‘, bekräiwe ‘begreifen‘, Klock ‘Glocke‘, Knaad ‘Gnade‘, Kròòt ‘Grat‘,
kraddeleere ‘gratulieren‘ und Klobus ‘Globus‘ - ein g in einer Konsonatenverbindung am Wortanfang bekommt der
Mayener nicht hin. Damit ist es noch nicht genug: Auch r, ch und sch können an Stelle von standardsprachlichem
g auftreten, etwa in fròòre ‘fragen‘, fròòch ‘frage‘ und fr`ö`öschs ‘fragst‘ oder auch in Feischling ‘Feigling‘.
Auch b (stimmhaft) und p (stimmlos) werden, was vielleicht nicht ganz so auffällig ist, nicht an denselben
Stellen wie
in der Standardsprache gebraucht, sondern sind gegeneinander „ausgetauscht“: also Labbe statt ‘Lappen‘, schlebbe
‘schleppen‘ und umgekehrt Ploom statt ‘Blume‘, Prand statt ‘Brand‘. Während die Lautkombinationen p + l und p +
r am Wortanfang kein Problem sind, Pl`ö`öt ‘Platte, Glatze‘ und Priml ‘Primel‘, sind ein b + l, Ploot ‘Blut‘,
und b + r, Pruut ‘Brot‘ für den Mayener kaum sprechbar. Die Lautverschiebung
von d zu t am Wortanfang hat das
Mayener Platt nicht mitgemacht, sondern wie das Englische den alten westgermanischen Lautstand bewahrt, so dass
es Deer ‘Tier‘, Daach ‘Tag‘, doon ‘tun‘, deef ‘tief‘, Düür ‘Tür‘, danse ‘tanzen‘ heißt und dem Englischen sehr
nah ist: deer - Hirsch, Reh, day – Tag, do – tun, deep – tief, door – Tür, dance – tanzen. Aber es gibt auch
Übereinstimmungen mit der Standardsprache: Tee, Teller Tasse, Tapert
, und umgekehrt z. B. tisbedeere
‘disputieren‘ geht es ebenfalls. Auch die Lautkombinationen sp- und st- sind häufig „stimmhaft“, z. B. heißt
‘spülen‘ schbööle, ‘spaßig‘ schbassésch und ‘Stecken‘ Schdegge, ‘Stadt‘ Schdadt
, dagegen aber ‘Strafe‘ Stròòf,
‘Straße‘ Stròòß und ‘Sprung‘ Sprung, ‘Sprenkel‘ Spreng-gel, ‘springen‘ sprénge, ‘Spritzgebäck‘ Sprétzjebäck(s).
Trotzdem sind das Mayener sp- und st- weicher als in der Standardsprache. Äußerst auffallend ist der Erhalt von
altem unverschobenem t im Auslaut, d. h. am Wortende, statt standardsprachlichem s in dat, wat und et, d. h.,
das Mayener Platt hat diese Verschiebung nicht mitgemacht. Diese „Kleinwörter“ kennzeichnen eine wichtige Grenze
der zweiten Lautverschiebung.
In der Literatur werden meist nur diese drei als „erhaltene“ Wörter angeführt.
Tatsächlich findet man aber im Mayener Platt zahlreiche weitere: Beim Adjektiv für das Neutrum heißt es e neuet
‘ein neues‘, e aalet ‘ein altes‘, e kruuset ‘ein großes‘ etc., z. B. Dat Himm és e neuet / e aalet. ‘Das Hemd
ist ein neues / ein altes.‘ Dagegen heißt es aber immer ebbes Neues ‘etwas Neues‘, ebbes Aales ‘etwas Altes‘,
ebbes Kruuses ‘etwas Großes‘ etc. Beim Possessivpronomen heißt es t bzw. d statt standardsprachlich s: mäint,
däint, säint, oost (ooset), euert (euret), ihrt (ihret) ‘meins, deins, seins, unser(e)s, euer(e)s, ihr(e)s‘ bzw.
mäinde, däinde, säinde, oosde euerde, ihrde ‘meines (eig. meindes; etc.), deines, seines, unsres, euers, ihres‘
, z. B. Dat Himm és mäint/mäinde, däint /däinde. ‘Das Hemd ist meins /meines, deins /deines.‘
Drittens wird
der Superlativ für die 3. Pers. Sg. und Pl. für das Neutrum in Fällen wie Dat Audo? Dat és säi /ihr / säi
neuesdet / besdet / krüüßdet. ‘Das Auto? Das ist sein / ihr / sein / neuestes /bestes /größtes.‘ Auch im Plural:
Ihr neuesdet / besdet / krüüßdet. ‘Ihr neuestes /bestes /größtes.‘ Und viertens enden auch die Zahlwörter ‘eins‘
und ‘keins‘ im Platt auf t: aant und kaant bzw. de: aande und kaande.
- Weitere Beispiele zu j finden sich in den Ausführungen zum Svarabhakti in Kapitel 4. ↩
- Siehe hierzu Kapitel 1. ↩
- Oder auch: Babba statt ‘Papa‘, bótze statt ‘putzen‘; dagegen: plòò statt ‘blau‘, Präi statt ‘Brei‘, Plesch statt ‘Blech‘. Und: Deisch ‘Teig‘, Däär ‘Teer‘, Daal ‘Teil‘, deuer ‘teuer‘ und dagegen: Treck ‘Dreck‘, Tròht ‘Draht‘, treuzehn ‘dreizehn‘. ↩
- Auf die Schreibung schb- bzw. schd- wird der besseren Lesbarkeit wegen im Wörterbuchteil verzichtet. ↩
- Vgl. Kapitel 1. ↩
- Vgl. hierzu auch Kapitel 12 zum Possessivpronemen. ↩
4. Weglassen und Verbinden
Bääsm, Abbl, mööd, Tösch, Käär, Kérresch, Schakal. Vom Weglassen, von Sparsamkeit, vom Hinzufügen und Verbinden. Die Apokope, das Svarabhakti, die Liaison und der Sandhi
Einerseits lässt der Mayener gern Laute weg, andererseits fügt er gern welche hinzu, so dass das Mayener Platt
sich nicht nur mit seinen Vokalen und seinen Mitlauten von der Standardsprache abhebt, sondern auch durch seine
Wortformen. Er lässt im Wort Laute aus, etwa bei Jedäschnis ‘Gedächtnis‘, Naachskied(e)l ‘Nachthemd; wörtl.:
Nachtkittel‘, Jekochs ‘Gekochtes‘, Jehacks ‘Gehacktes‘, Schwinnsucht ‘Schwindsucht‘) und auch bei Bännl ‘Bändel‘
, Buggl ‘Buckel‘, Bääsm ‘Besen‘ und Abbl ‘Apfel‘.
Sparsam ist der Mayener speziell am Wortende – eine Eigenheit, die auffällig ist. Ganz typisch ist der Abfall von
zum Wortstamm gehörigem -e im Auslaut, d. h. am Wortende, (die sogenannte e-Apokope): Kést ‘Kiste‘, Auch ‘Auge‘
, Tösch ‘Tasche‘, Büchs ‘Büchse‘, Fall ‘Falle‘, Kann ‘Kanne‘, mööd ‘müde‘, schad ‘schade‘, mäin ‘meine‘. Ebenso
ist es mit dem Abfall von standardsprachlichem -n (n-Apokope), etwa bei Substantiven (wie beispielsweise Owe
‘Ofen‘, Steer ‘Stirn‘, Hoor ‘Horn‘, Käär ‘ Kern‘, Koor ‘Korn, Roggen‘) sowie am Wortende von Verben (z. B. ääse
‘essen‘, paseere ‘passieren‘, sööje ‘suchen‘, bäise ‘beißen‘). Auch -es bzw. –nes bei standardsprachlichen
Bildungen wie ‘großes‘ kruuß, ‘schönes‘ schöö, ‘kleines‘ klaa
und -et beim Partizip Perfekt, etwa jereet
‘geredet‘, énjebilt ‘eingebildet‘
fallen ab. Auch das r fällt bei bestimmten Wortbildungen regelmäßig ab: Es
heißt grundsätzlich en aale (Mann) / en Aale ‘ein alter (Mann) /ein Alter, en frümme (Mann)/en Frümme ‘ein
fremder (Mann) / ein Fremder‘, en duude (Mann) / en Duude ‘ein toter (Mann) / ein Toter. Von besonderem
sprachwissenschaftlichen Interesse sind, weil das ungewöhnlich ist, Substantivformen, bei denen die Pluralform
kürzer als die Singularform ist
, nämlich Hünn ‘Hunde‘, Hänn ‘Hände‘, Wänn ‘Wände‘, Stänn ‘Stände‘, Döör
‘Dornen‘ (veraltet?). Ebenfalls kommt der Abfall ganzer Silben beim Singular vor: Bier (‘Birne‘), Enn (‘Ende‘),
Schann (‘Schande‘), Kunn (‘Kunde‘), Stunn (‘Stunde‘) (Sg. und Pl.).
Wörter wie etwa rääne ‘regnen‘, Rään ‘Regen‘, jään ‘gegen‘, sääne ‘segnen‘, Wòòn ‘Wagen‘, Hòòljans ‘Hagelgans‘,
Märsch ‘Mähre‘ (ausgestorben?), deren Form zwar sehr verschieden von der standardsprachlichen ist, aber keinen
Abfall von Endungen haben, werden hierzu nicht gezählt. Sparsam geht der Mayener auch mit dem e [ə] in
bestimmten Positionen im Wort um, was aber, auch für einen Mayener, eher weniger auffallend ist. Obwohl es
durchaus möglich ist, es mitzusprechen, fehlt es i. d. R., z. B. in bääd(e)le [ˈbɛː¹d(ə)lə] ‘betteln‘,
Pud(e)lfass [ˈpuː¹d(ə)lfas] ‘Jauchefass‘, Nòòd(e)l [ˈnɔː¹d(ə)l] ‘Nadel‘, hann(e)le [ˈha¹n(ə)lə], Frad(e)l
[ˈfʁɑː¹d(ə)l] ‘Freidel; starkes Holzstück oder Stoffstreifen‘, wagg(e)le [ˈvɑg(ə)lə] ‘wackeln‘. Sozusagen als
Ausgleich, als Gegenzug zum Weglassen, kann die Vorliebe des Mayeners, ein e [ə] einzuschieben, gesehen werden.
Wie auffallend dieses Phänomen für einen Nicht-Mayener-Platt-Sprecher ist, kann nicht beurteilt werden.
Beide
Phänomene kommen nicht selten in einem Wort vor. Beispiele für Substantive mit Kombination von Endungsabfall
und gleichzeitigem Einschub von e [ə] sind ‘Birke‘ und ‘Kirche‘, die dreisilbig würden (*Béreke und *Kéresche),
wäre da nicht der –e-Abfall im Auslaut, also Bé-rek und Ké-resch (mit von der Standardsprache abweichender
Silbengrenze).
Verschiedene Mayener Verben, nämlich die, die auf –len oder –ren enden, sammele (*sammelen)
‘sammeln‘ und ärjere (*ärgeren) ‘ärgern‘ haben eine e-Tilgung im Gegensatz zu den entsprechenden in der
Standardsprache nicht vollzogen, weder im Infinitiv noch in der 1. Pers. Sg. Präs. oder in der 1. und 3. Pers.
Pl. Präs.
Aber nicht nur in diesen speziellen Fällen, sondern durchgängig bei bestimmten Lautverbindungen
tritt der
e-Einschub auf, und zwar in allen Wortarten (-lch Mélesch ‘Milch‘, Pólesch die Stadt ‘Polch‘, bellesch ‘welch,
welche‘, -lk dölege dülken '(nieder)schlagen, zurechtstutzen, züchtigen', Vólek (Volk, d. h. ‘Gesindel‘),
-lg Ballesch ‘Balg‘,gl- jelääm glem (ausgestorben?) 1. 'zart, sanft, behutsam'. - 2. 'fügsam, zahm, willig',
-rk kirekse ‘kirksen "knarrendes, schrilles, nervenschmerzendes Geräusch erzeugen durch Aneinanderreiben; neue
Schuhe, zwei sich reibende Äste, schlecht geschmierte Räder, Wiegen, Schlösser, Türen udgl." (RHEIN. 4, 533)‘,
-rch doresch ‘durch‘, Stòresch ‘Storch‘, -rg arsch ‘arg‘, -rl Märel Merle ‘Amsel‘, -rm arem ‘arm‘, -lm Qualem
‘Qualm‘.
In der Standardsprache, die im doppelten Sinn eine „Kunstsprache“ ist, ist die korrekte Aussprache eines Wortes
festgelegt.
Im Platt, das eine mündliche Varietät ist
, gibt es dagegen Varianten. Häufig, aber nicht
ausschließlich, entstehen diese durch die Anpassung von Lauten an benachbarte.
Dies geschieht im Mayener Platt
am Wortanfang, di- (‘direkt‘: derekt, jerekt, irekt), ge- (‘genug‘: jenooch(t), inooch(t)); ‘genau‘: jenau,
inau; ‘geduldig‘: id´öllésch, jed´öllésch), über- (‘überhaupt‘: üüwahaup(t), jehaup(t)), (‘sogar‘: zejaa, sejaa,
zijaa) und innerhalb eines Wortes, -ge- (‘ungesund‘: onjesónt, onisónt; ‘angeholt‘: anjehólt, anihólt). Auch
zwei Wörter, die aufeinander treffen, z. B. bei hadder ‘habt ihr‘, jahsde ‘gehst du‘, én’t ‘in es‘ (= in das),
jémma ‘gib mir’, werden aneinander angeglichen. Und allein durch Austausch von e gegen i, von jémma zu jimma,
wird aus ‘gib mir’ ‘gehen wir‘. Hierher gehört auch die alte scherzhafte Aufforderung: „Sòò aas en Satz mét
Schakal!“ (‘Sag mal einen Satz mit Schakal!‘). Die „richtige“ Antwort heißt: Schakaal Fööß. ‘Ich habe kalte
Füße.‘ Obwohl diese Lautanpassung, die die Aussprache vereinfacht, nicht zwingend ist, ist sie die Regel und
wird stets praktiziert - ohne sie geht Mayener Platt nicht. Folge der vereinfachten Aussprache durch Angleichung
ist, dass ein ganzer Satz „am Stück“ gesprochen wird.
Für einen Mayener kein Problem, wird dies für einen
Fremden zur Herausforderung. Das „Entschlüsseln“ des Mayener Platts ist schwierig, da für Fremde nicht ohne
Weiteres festzustellen ist, wo ein Wort endet und wo das nächste beginnt: Éschhóllendarawäilenoch. ‘Ich hole
dir derer (=davon) jetzt noch‘. Naukuggaaselòh - nau küddat häi méddeplaggéje Fööß jelóff. ‘Nun guck mal da
(= Nun sieh mal an) - jetzt kommt das (Kind) hier mit den nackten Füßen gelaufen‘. ‘schwòabäiara anna Frau.
‘Ich war bei einer anderen Frau‘. Kannendakaan annaaal Bócks andoon? ‘Kann er denn keine andere alte Hose
anziehen?‘Owaas kòmenallerhand Leuderénn. ‘Plötzlich kamen allerhand Leute herein‘. Jéww-ed-em-aas
jerat. ‘Gib es ihm mal gerade‘. Lòh-küdd-et-at. ‘Da kommt es schon‘. És-et-add-esu-wäit?
‘Ist es schon so weit?‘
- Vgl. hierzu aber auch Kapitel 10. Darüber, ob es sich bei diesem Abfall um Apokope handelt oder ob das Adjektiv nicht flektiert, d. h. gebeugt, wird, kann keine Aussage gemacht werden. ↩
- Weitere Beispiele: ermort ‘ermordet‘, jelant ‘gelandet‘, jemelt ‘gemeldet‘, jerett ‘gerettet‘. ↩
- Dies ist der sogenannte Subtraktive Plural (vgl. BIRKENES 2014). ↩
- Zum eingeschobenen e [ə]: „Der Sprossvokal (auch: Anaptyxe, griechisch ἀνάπτυξις anáptyxis „Entfaltung“; sanskr. Svarabhakti, „der Vokal aus der mittleren Reihe“) ist eine Unterkategorie der Lauteinschaltung, also ein Vorgang, bei dem durch Änderung der Silbenstruktur die Aussprache erleichtert wird. Dies geschieht in diesem Falle durch silbenbildenden Einschub eines Vokals“. (Hervorhebung im Original) (https://de.wikipedia.org/wiki/Sprossvokal). ↩
- Dreisilbigkeit würde der Pluralform entsprechen (mit leicht abweichender Aussprache): Bérege, Kéreje. Genauso ist es bei Nelek (Pl. Nelege) ‘Nelke‘ und Wolek (Pl. Wolege) ‘Wolke‘. ↩
- Vgl. hierzu Kapitel 8 und Kapitel 9 Von den Formen des Substantivs. Siehe hierzu auch DUDEN GRAMMATIK, 120, 195. ↩
- Es sind nicht alle Kombinationen aufgeführt. ↩
- Weitere Beispiele: gl- (‘sei folgsam‘, wörtl.: ‘folge‘), jeladdésch (glatt), Jelass ‘Glas‘, jelauwe ‘glauben‘, jeläisch ‘gleich, bald‘, jeläije ‘gleichen‘, jel´öcklésch ‘glücklich‘; -rk murksen, zirkeln, borkig, Ferkel, Mark, fuhrwerken, Gurke, Korken, merken; -lm Palm; -lk Balken, walken, Kalk, melken, molkig, Nelke, Wolke, schalkig, ulkig; -lch Dolch, ‘Poljer‘ Polcher, strolchen, welch, durch, Durcheinander, Durchzug, Kirchenlicht, Kirchhof, schnarchen, Storch; -lg Felgen, folgen, Galgen, vertilgen. ↩
- 1898, also vor rund 120 Jahren, hat THEODOR SIEBS auf der Basis der norddeutschen Aussprache ein Wörterbuch herausgegeben (Deutsche Bühnenaussprache). Bis dahin gab es keine einheitliche Aussprache von Wörtern, sondern man sprach nach der in der Schule gelernten, durch den eigenen Dialekt geprägten Leseaussprache „hochdeutsch“. Mit dieser nun vorgegebenen Bühnenaussprache gab es erstmals eine Norm, nach der Sprecher trainiert wurden, damit nicht mehr die einen auf der Biehne von den Kistenbewohnern und die anderen auf der Bühne von den Küstenbewohnern reden sollten. Diese zunächst sehr künstliche Aussprache wurde in gemäßigter Form ab ca. 1930 von professionellen Sprechern in Funk (und später auch Fernsehen) gebraucht. Die Hörer haben sich zunehmend an ihr orientiert, sie wie ein Virus verbreitet und sie dadurch zu unserer heutigen hochdeutschen Standardsprache gemacht. ↩
- Zum Varietätenbegriff: Der Dialekt (für Mayen: das Platt), als rein mündliche, „unterste“ Sprachschicht, die „darüber liegende“ Umgangssprache, der Regiolekt, und die „zuoberst liegende* Standardsprache, in mündlicher und schriftlicher Form, sind die drei Varietäten der deutschen Sprache. D. h., Mayener Platt ist eine Form der deutschen Sprache. Daher sind Bezeichnungen wie Mayener Spròòch zu vermeiden. Die Sprache ist deutsch. ↩
- Der Fachbegriff hierfür heißt Sandhi. „Sandhi ([...] ‘Zusammensetzung‘)“ beschreibt „[...] Änderungen beim Zusammentreffen von zwei [...]“ Wörtteilen und „Wörtern“. „Sandhi dient der Vereinfachung der Aussprache [...]“. „Alle Sprachen des Rheinlands und seiner Umgebung (Rheinhessisch, Pfälzisch, Luxemburgisch, Ripuarisch, Limburgisch) kennen ihn in unterschiedlicher, häufig optionaler Form.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Sandhi. ↩
- Dieses Aneinanderbinden von Wörtern hat auch das Französische. Es wird als Liaison bezeichnet. Zu Liaison siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Liaison_(Sprachwissenschaft). ↩
5. Fehlende Wörter
Hólle, liehre, linne oder: nehmen, lernen, leihen. Was der Mayener nicht kennt. Etwas zum Wortschatz
Trotz des Fehlens verschiedener Wörter ist es dem Mayener möglich, alles auszudrücken, was er möchte - das
meiste jedenfalls. Allerdings bekam Fredi nach seiner Mitteilung: „Ésch hann en Taplett jehóllt. ‘Ich habe eine
Tablette geholt.‘“ von Renate zu hören: „Dann nimm sie doch auch!“ Genau das hatte er getan! Der Mayener kennt
nur holen, aber nicht nehmen. Es wird ausschließlich geholt. Holen und nehmen fallen in ihrer Bedeutung
zusammen: Man holt dem Kind die Schere ab, holt jemandem die Zeitung fort. Man holt zwei Kilo ab (oder zu),
holt ein Video auf, überholt ein Geschäft, holt den Einbrecher fest, holt sich nicht nur den Tod, sondern auch
das Leben - und holt die Maul voll. Die Maul ist nicht identisch mit dem standardsprachlichen ‘das Maul‘,
sondern es ist das normale Wort für ‘Mund‘
. Dem echten Platt ist ‘Mund‘ fremd.
Die Reaktionen auf die
Aufforderung haal de Maul ‘halte den Mund‘ und haal et Maul ‘halte das Maul‘ fallen beim Mayener mit
Sicherheit unterschiedlich aus. Gelernt wird in Mayen auch nichts. Es wird nur gelehrt: "die MA. hat für die
beiden nhd. Wörter lehren u. lernen nur das eine Wort lehren" (RHEIN. 5, 315). Wie standardsprachlich heißt es:
Ésch wäären désch / denn Anstand lihre! ‘Ich werde dich / ihn (wörtl.: den) Anstand lehren.‘ Dat säimir su
jelihrt wure. ‘Das hat man uns so gelehrt. Wörtl.: Das sind wir so gelehrt worden.‘ Leefje, ésch lihren désch
strégge. ‘Liebes, ich lehre dich stricken.‘ Es heißt aber auch: Hadda nét waade jelihrt? ‘Habt ihr nicht warten
gelernt (wörtl.: gelehrt)?‘ Der lihrt nét jäär. ‘Er lernt nicht gern.‘ Dumm jebore ón neust dòzoo jelihrt!
‘Dumm geboren und nichts dazu gelernt (wörtl.: gelehrt.‘ Auch ‘(ver)leihen‘ kann man im echten Mayener Platt
nichts, höchstens (ver)linne ‘(ver)lehnen‘: Kannsde ma däi Audo linne? ‘Kannst du mir dein Auto leihen (wörtl.:
lehnen)?‘ Ésch linnen daret bés nächsde Wóch. ‘Ich leihe (wörtl.: lehne) es dir bis nächste Woche.‘ Linn ma aas
däin Schär! ‘Leihe (wörtl.: Lehne) mir mal deine Schere!‘ Jelinnt és nét jeschenkt! ‘Geliehen (wörtl.: Gelehnt)
ist nicht geschenkt!‘ Hasde däi Radd verlinnt? ‘Hast du dein Rad verliehen (wörtl.: verlehnt)?‘ Und
andererseits: Ma mösen us bäi da Oma jet Pruut linne. ‘Wir müssen uns bei Oma etwas Brot leihen (wörtl.:
lehnen).‘ Kummda widder Klopabier linne? ‘Kommt ihr wieder Klopapier leihen (wörtl.: lehnen)?‘ und: Denn
Pullover hann ésch ma vóm Tina jelinnt. ‘Den Pullover habe ich mir vom Tina geliehen (wörtl.: gelehnt).‘
Der echte Mayener spricht nicht, schweigt auch nicht, arbeitet nicht, schimpft nicht, weint nicht, geht nicht im
Wald spazieren, ist nicht klug, bekommt keine Schmerzen und keine Angst, streitet sich nicht, wird nicht wütend
– e schwätzt oder schwätzt nét, és st´öll ón hält de Maul, schafft, schännt ‘schändet‘, heult, pr´öllt ‘brüllt
(=weint!)‘, flózzt, knaatscht ón watzt, jaht én de B´ösch, és jescheut, krischt Päin ‘Pein‘und Schregge
‘Schrecken‘, tisbedeert ón zänkt sésch ón würd ròòsend ‘rasend‘, ón bäim Jewidder mooß ma em de Kräul aafhaale
‘und beim Gewitter muss man ihm beistehen; wörtl. und beim Gewitter muss man ihm die Gräuel abhalten‘ – óch
wemma selwer kräult ‘auch wenn man selbst Angst hat‘. Und wenn der Mayener Zännpäin ‘Zahnschmerzen‘ hat,
übertreibt er - wörtlich genommen tun ihm gleich mehrere Zähne weh.
‘Hier und dort‘ heißt häi ón (e)lòh ‘allda‘, statt ‘dieses und jenes‘ häi dat ón lòh dat, ‘jetzt‘ heißt nau
‘nun‘ oder (e)wäile ‘(alle)weil‘. ‘Hinein‘ und ‘hinaus‘ kennt der Mayener ebenso wenig wie ‘hinauf‘ und
‘hinunter‘, für beide Richtungen gibt es nur her-, also erénn ‘herein‘, eraus ‘heraus‘, eróf ‘herauf‘ ón erunner
‘herunter‘. Damit nicht genug: ‘Bitten‘ wird umschrieben, statt ‘fassen‘ und ‘greifen‘ wird gepackt, ‘Gott‘ ist
der liebe Gott oder der Herrgott, ‘Getreide und Roggen‘ waren (früher) nur Koor, ‘Kohl‘ ist Kabbes, ‘die Pfütze‘
ist der Pudel. Der Morje dauert bis mittags (‘Vormittag‘ gibt es nicht), ‘Schmutz‘ ist Dreck, ‘die Wange‘ ist
dat Back, ‘der Topf‘ ist dat D´öbbe, ‘schauen‘ ist kugge, ‘lieben‘ ist jär hann (‘gern haben‘), ‘töten‘ ist duut
maare, statt ‘schnell‘ ist man flótt oder huddésch ‘hurtig‘, ‘versuchen‘ heißt probeere („probieren steht allg.
für proben u. das fehlende versuchen“ (RHEIN. 6, 1120)) und auch ‘trocknen‘ und ‘trocken‘ sind nicht echt
mündlich, sondern treuje ‘drügen‘ und treusch ‘drüge‘.
6. Vokale
Kétt ón Kätt, Hoor ón Hòòr, heiß, Staan, Päin. Der Vokalismus (J. E. SCHMIDT)
Weshalb andere das Moselfränkische als „wild“ und „bunt“ empfinden und weshalb es von Fremden schlechter verstanden wird als etwa das Pfälzische oder die ostmitteldeutschen Dialekte, lässt sich schön am Vokalismus des Mayener Platts zeigen. Das Mayener Platt hat mit 24 Vokalen (Selbstlauten) und Diphthongen (Zwielauten), deutlich mehr vokalische Laute als die Standardsprache (18) oder das Pfälzische (16), und zudem sind die Vokale in Mayen deutlich anders auf den Wortschatz verteilt. Bei den Langvokalen ist ihre Zuordnung zu bestimmten Wörtern im Vergleich zur Standardsprache oder zum Rheinfränkischen sozusagen „vertauscht“. Das hat historische Gründe: Wie die anderen rheinischen Dialekte hat das Mayener Platt seit der Entstehung des Deutschen vor ca. eineinhalbtausend Jahren eine eigenständige historische Grundlage, das Altwestdeutsche , die sich von allen übrigen deutschen Dialekten unterscheidet. Zudem hat das Rheinische, und damit Mayen, z. T. sehr alte (Kurzvokalimus) oder alte vokalische Unterscheidungen (z. B. Umlaute, d. h. ü, ö) bewahrt, die in vielen andern Dialekten aufgegeben wurden.
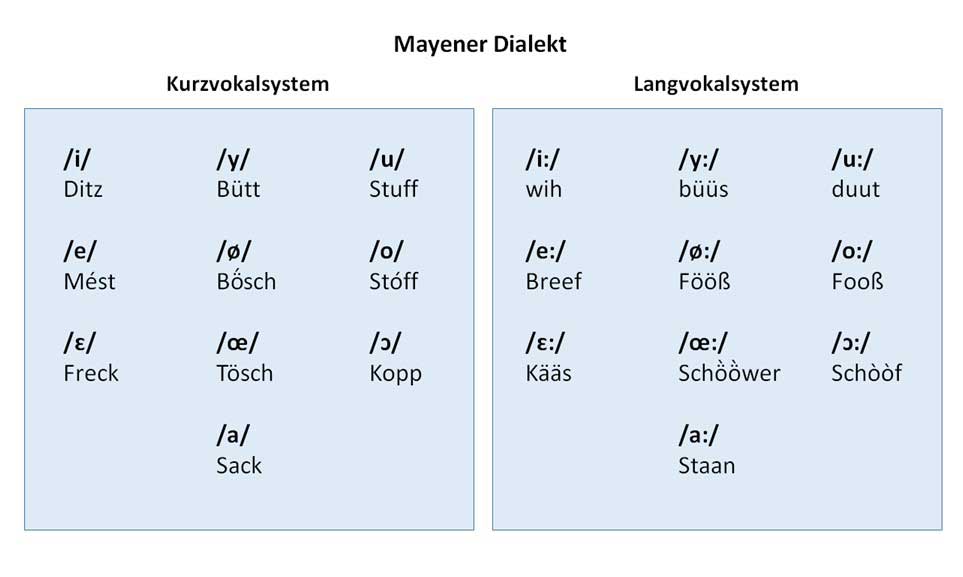
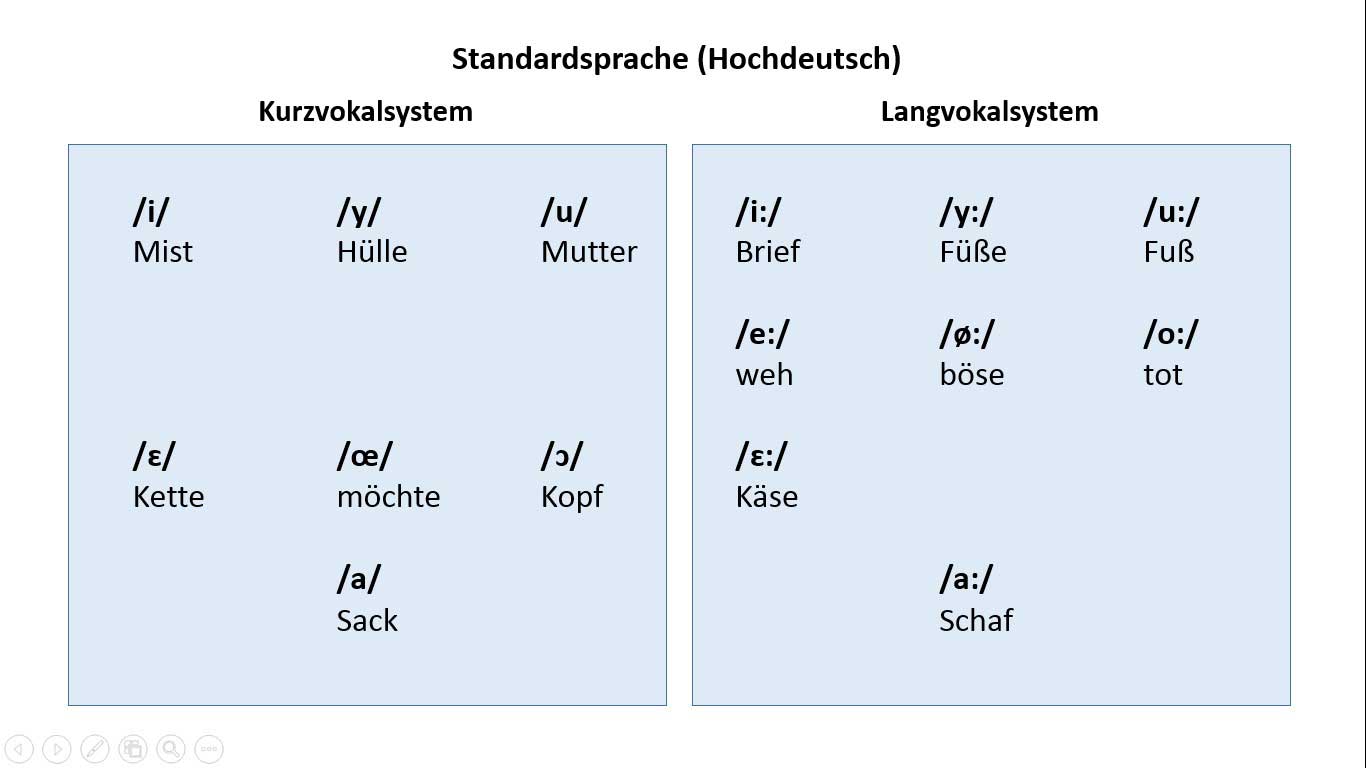
In der obigen Abbildung sind die Kurzvokale und die Langvokale des Mayener Platts und der Standardsprache
gegenübergestellt. Die Darstellung ordnet die Vokale nach Lautreihen, die der Zungenhöhe sowie dem Öffnungsgrad
des Mundes bei der Vokalartikulation entsprechen. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass der geöffnete
Mundraum schematisch abgebildet ist: i, ü, und u werden hoch im Mundraum mit der Zunge hoch am Gaumen gebildet.
Geschlossenes e (Mést), ö (B´ösch) und o (Stóff) mit mittlerem Öffnungsgrad und mittlerer Zungenposition und
/ɛ/ Freck, /œ/ Tösch /ɔ/ Kopp noch etwas offener und die Zunge noch etwas tiefer und/a/ weit offen mit Zunge
unten im Mundraum. Man sieht unmittelbar, dass das Mayener Platt im Gegensatz zur Standardsprache 1. sowohl bei
den Kurzvokalen als auch bei den Langvokalen vier Öffnungsgrade unterscheidet, 2. über genau dieselben
Kurzvokale wie Langvokale verfügt (symmetrisches Kurz- und Langvokalsystem) und 3. damit die
Unterscheidungsmöglichkeiten des Deutschen für einfache Vokale (Monophthonge) voll ausnutzt. Das hat zur Folge,
dass Mayen über eine Vokalreihe mit geschlossenen Kurzvokalen verfügt (/e/, /ö/, /o/), die in der
Standardsprache fehlt. In der Standardsprache wird Kette zwar mit <e> geschrieben, aber mit ä (= [ɛ])
gesprochen. Im Mayener Platt sind kurz e und ä dagegen bedeutungsunterscheidend: Einem geschlossenen e in
Kett (= ‘Kette‘) steht ein offenes ä in Kätt (= ‘Käthe, Katharina‘) gegenüber. Parallel hat das Mayener
Platt auch zwei kurze o-Laute. Während die Standardsprache nur das offene /ɔ/ wie in Loch kennt,
unterscheidet das Mayener Platt zwischen Bóckse (= ‘Hosen‘) mit geschlossenem o und boxe (= ‘boxen‘) mit
kurzem offenem o-Laut.
Bei den Langvokalen sind die Verhältnisse ähnlich. Während die Standardsprache hier
nur jeweils einen langen o-Laut und einen langen ö-Laut kennt, verfügt Mayen über zwei lange o-Laute und
zwei lange ö-Laute: Langem geschlossenen o in Fooß, Stohl, roowe (‘Fuß, Stuhl, rufen‘) steht langes
offenes /o/ in Schòòf, Pòòl, sòòn (‘Schaf, Pfahl, sagen‘) gegenüber; langem geschlossenen ö in Fööß,
Jemöös, sööß, Prööder [ˈpʁøː¹dɑ] ‘Brüder‘ steht langes offenes ö in Sch`ö`öwer ‘Schäfer‘, Pr`ö`öder
[ˈpʁœː¹dɑ] ‘Bräter‘, N`ö`öl ‘Nägel‘ gegenüber.
Nicht abgebildet sind die Zwielaute (Diphthonge): Die Standardsprache verfügt über drei (/ai/ - /oi/ - /au/),
die ganz ähnlich auch im Mayener Platt auftreten, Mayen hingegen über vier, da hier zwei /ai/-Laute
unterschieden werden: Neben dem auch in der Standardsprache vorkommenden /ai/ in Wörtern wie Ei, kennt das
Mayener Platt zusätzlich ein äi [ɛi] in Wörtern wie Späija ([ˈʃbɛi²jɑ] ‘Speicher‘), Bäil [bɛi²l] ‘Beil‘, träi
[ˈtʁɛi²] ‘drei‘. Die wahrscheinlich auffälligste Besonderheit des Mayener Vokalismus besteht in der Verteilung
der Langvokale im Wortschatz. Weil das Rheinische seit Entstehung des Deutschen über ein eigenständiges
Vokalsystem verfügt und zudem seither eine eigenständige Entwicklung durchlaufen hat, treten heute auch die
Langvokale, die sowohl dem Mayener Platt als auch der Standardsprache angehören, fast immer in verschiedenen
Wörtern auf. Wie die Abbildung erkennen lässt, ist dabei für die beiden obersten Langvokalreihen die Zuordnung
der Langvokale zu den entsprechenden Wörtern vertauscht. Wo die standardsprachlichen Wörter langes i – ü – u
aufweisen (Brief, Füße, Fuß) hat Mayen langes e – ö – o (Breef, Fööß, Fooß) und umgekehrt: Wo die
standardsprachlichen Wörter langes e – ö – o (weh, böse, tot) aufweisen, hat Mayen i – ü – u (wieh, büüs, duut).
7. Rheinisches Singen
Räi1f ón Räi²f, Dau1f ón Dau²f. Rheinische Töne oder: Tonakzente (mit J. E. SCHMIDT)
Das erste, das man an einer fremden Sprache oder einem fremden Dialekt wahrnimmt, ist wohl der Klang. Und der des
Mayener Platts ist für Nicht-Rheinländer extrem ungewöhnlich. Ursache hierfür ist die hoch auffällige
Wortprosodie (der „Tonfall“), die schon genannten Tonakzente. Dieses Phänomen, das auch als Rheinische
Akzentuierung bezeichnet wird, kommt in Deutschland nur im Rheinischen (Moselfränkisch und Ripuarisch) vor.
Seit etwa 170 Jahren, seit HARDT 1843
wurde versucht, dieses Phänomen zu (er)klären. Die vielen Termini, mit denen man
es schon bezeichnet hat, belegen dies: Umgangssprachliche Bezeichnungen sind rheinischer Singsang, rheinisches
Singen. Der heute gebräuchliche TerminusTonakzent wurde von SCHMIDT
geprägt. Ältere, heute nicht mehr
gebräuchliche Begriffe sind für Tonakzent 1 „Korreption (HARDT 1843), Akutus (AHUUS 1868), rheinischer Akzent
(SIEVERS 21881), gestoßener, springender Akzent (NÖRRENBERG 1884), Brechung (DIEDERICHS 1886) […] Schärfung
(FRINGS 1913)“ u. v. m. Terminusvarianten für Tonakzent 2 sind „Schwebelaut (zuerst HARDT 1843), Gravis
(AHUUS 1868), Dehnung (DIEDERICHS 1886), schwachgeschnittener Akzent (BALDES 1895/96), Trägheitsakzent
(WELTER 1933)“ und weitere.
Die Tonakzente haben der Forschung lange Zeit Rätsel aufgegeben. Unklar war vor
allem, woran genau ein Hörer die beiden Tonakzente unterscheidet und ob zwischen den Tonakzenten und dem
Ausdruck von Emotionen, Gemütsbewegungen, Emphase, Intensität oder Eindringlichkeit ein Zusammenhang besteht.
Diese Fragen konnten inzwischen geklärt werden, wobei gerade Mayen als Untersuchungsort für experimentelle
Studien diente.
Heute ist klar, dass es sich bei den Tonakzenten um sprachliche Einheiten handelt, die der
Unterscheidung von Wortbedeutungen und grammatischen Formen dienen. Anders ausgedrückt: Die Tonakzentopposition
ist distinktiv, also bedeutungsunterscheidend. Durch das Sprechen einer Folge von Lauten, etwa [maːt], mit dem
einen oder dem anderen Akzent ändert sich ihre Bedeutung: Mit Tonakzent 1 gesprochen bedeutet die Lautfolge
‘Made‘ [maː¹t], mit Tonakzent 2 ‘Markt‘ [maː²t] (1 steht für Tonakzent 1, ² für Tonakzent 2). Solche, sich nur
im Tonakzent unterscheidenden Wortpaare, sogenannte Minimalpaare, sind im Mayener Platt z. B.: Dau1f ‘Taube‘
und Dau²f ‘Taufe‘, Räi1f ‘Reibe‘und Räi²f, ‘Reif‘, Ma1nn ‘Wäschekorb‘ und Ma²nn ‘Mann‘. ‘Herde‘ – ‘Herd‘,
‘Falle‘ – ‘Fall‘, ‘Graf‘ – ‘Grab‘, ‘Grenze‘ – ‘Kränze‘, ‘Zeuge‘ – ‘Zeug‘ sind weitere Minimalpaare.
Auf diese
Weise werden jedoch nicht nur Wortbedeutungen, sondern auch grammatische Formen und Wortarten unterschieden.
Das betrifft z. B. den Numerus, also Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl), etwa Staa²n und Staa1n (‘Stein‘,
‘Steine‘), Schi²rm und Schi1rm (‘Schirm‘, ‘Schirme‘), und Kasus, etwa Hau²s und ém Hau1s (‘Nominativ: das Haus;
Dativ ‘in dem Haus‘), den Unterschied zwischen prädikativem und attributivem Adjektiv he²ll und he1ll (‘hell‘,
‘helle‘), wa²rm und wa1rm (‘warm‘, ‘warme‘) und den Unterschied zwischen Substantiv und Verb: Ha1nn und ha²nn
(‘Hahn‘, ich ‘habe‘), Ka1nn und ka²nn (‘Kanne‘, ich ‘kann‘). Es tragen aber nicht nur Wörter, die mit anderen
ein Minimalpaar bilden, diese Tonakzente, sondern der Mayener spricht diese Tonakzente in jedem Wort, das einen
Langvokal oder Diphthong (Zwielaut) enthält oder einen Kurzvokal vor einem sonantischen (d. h. klingenden)
Konsonanten, also vor l, m, n, ng, r. Das bedeutet, dass in Mayen die große Mehrzahl der Wörter untrennbar mit
einem Tonakzent verbunden ist. Daher werden diese beim Sprechen sowohl in den Regiolekt, die Umgangssprache,
als auch in die intendierte Standardlautung übernommen. Standardsprachlich klingen Rhein und rein, Meer und
mehr, meins und Mainz, Welt und wellt etc. gleich, nicht aber beim Mayener Sprecher – der intoniert sie
unterschiedlich, jeweils das erste Wort der Beispielpaare mit Tonakzent 2.
Die folgenden Abbildungen zeigen die akustischen Merkmale der Tonakzente: In der oberen ist der Tonhöhenverlauf
(Grundfrequenz) im Wortpaar Dau1f ‘Taube‘ und Dau²f ‘Taufe‘ abgebildet. Man sieht, wie die Tonhöhe bei
Tonakzent 1 fällt, bei Tonakzent 2 zuerst fällt, dann wieder ansteigt. In der unteren ist eine akustische
Gesamtanalyse des Wortpaars Ma1nn ‘Wäschekorb, Mande‘ und Ma²nn ‘Mann‘ wiedergegeben. Die auffälligen
Schwärzungen im Oszillogramm und im Spektrogramm lassen erkennen, wo der Kurzvokal endet und der Konsonant
beginnt. Man erkennt, dass das Wort mit Tonakzent 2 deutlich länger ist als das Wort mit Tonakzent 1 und dass
bei Tonakzent 2 im „klingenden“ Konsonanten ein Tonhöhenanstieg (= blaue gepunktete Linie) auftritt. Nach den
Analysen von WERTH 2011, die durch die EEG-Studien zu Mayen bestätigt wurden, ist es diese zweite Tonbewegung,
die die Hörer den Tonakzent und damit die Wortbedeutung erkennen lässt.
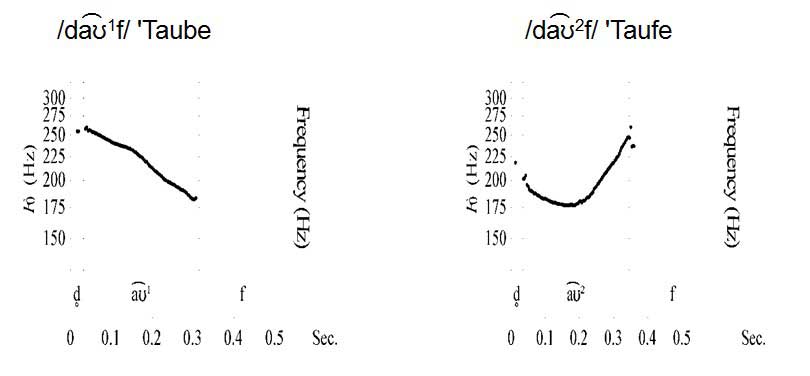
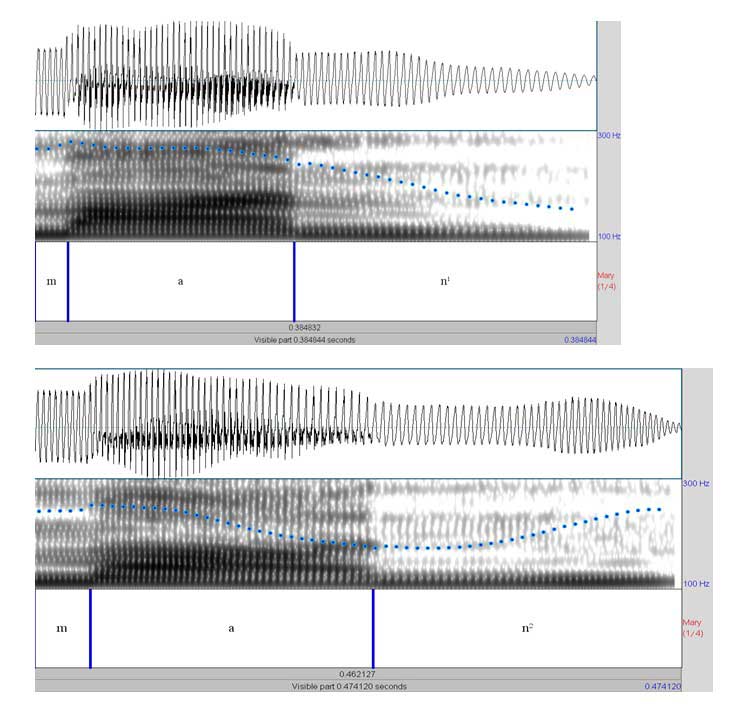
- Die Rheinische Akzentuierung setzt sich in Luxemburg, den deutschen Dialekten in Belgien und den südniederländischen Dialekten fort. Vergleichbares gibt es in den nordgermanischen Sprachen (Norwegisch, Schwedisch), Ähnliches im Dänischen. ↩
- Vgl. SCHMIDT 1986, 1. ↩
- Vgl. SCHMIDT 1986, 1. ↩
- Zit. nach SCHMIDT 1986, 1f., Fn. 10 u. 11. ↩
- SCHMIDT 1986; KÜNZEL / SCHMIDT 2001; WERTH 2011; SCHMIDT 2016 ↩
- Diese Minimalpaare gelten für Mayen. In anderen Dialekten bilden andere Wörter solche Paare. ↩
- Die Tonhöhenverläufe von Wörtern ändern sich zwar in Abhängigkeit von der Satzintonation. Die zweite Hälfte einer langen Silbe weist jedoch bei Tonakzent 2 immer eine relativ höhrere Tonhöhe (oder einen Tonhöhenanstieg) im Vergleich zu Tonakzent 1 auf. In der Sprachwissenschaft beschreibt man dies, indem man bei Tonakzent 2 von einem Hochton auf der zweiten More eines langen Silbenkerns spricht, der bei Tonakzent 1 fehlt. ↩
8. Verben
Ääse, tréngge, schlòòwe; ésch hann jääß, jetrónk, jeschlòòft; sésch anjénn, sésch kraddeleere, sésch tisbedeere; verschregge, verzélle, zerschlòòn; ésch leeßt, ésch möößt, ésch däät. Bés brav! Jangk haam! Ésch joong, kòòm, sòh. Dau würs désch wunnere! Et és am koche / am bótze / am Plätzjer bagge; jerooft were und jerooft kreen. Einiges von den Verben (Tätigkeitswörtern) und ihren Zeiten
Die Mayener Verben stimmen längst nicht alle mit den standardsprachlichen überein. Etliche unterscheiden
sich in ihren Formen oder im Gebrauch deutlich von diesen. Es „fehlen“ im Platt auch welche. Andere Formen
hat z. B. ‘sein‘ säin. Es heißt nicht wie Hochdeutsch ‘ich bin‘, sondern ésch säin ‘ich sein‘ (1. Pers.
Sg. Präs), z. B. Ésch säin mööd. ‘wörtl.: Ich sein müde.‘ und auch Ésch säin jange. ‘Wörtl.: Ich sein
gegangen.‘ Ebenso ist es bei mir säin ‘wir sein‘ statt ‘wir sind‘ (1. Pers. Pl. Präs.) und se säin
‘sie sein‘ statt ‘sie sind‘ (3. Pers. Pl. Präs.). Das Verb ‘haben‘ hingegen, ist nur lautlich von der
Standardsprache verschieden: ésch hann ‘ich habe‘, mir hann ‘wir haben‘ und se hann ‘sie haben‘.
Dafür enden aber die Präsensformen (Gegenwartsformen) der 1. Person Sg. (Einzahl) im Platt auf –n: ésch kummen
‘ich komme‘, jelauwen ‘ich glaube‘, kochen, lauwen, maanen, roowen, sammelen, wanderen.
Ésch rowen da an.
‘Ich rufe dich (wörtl. dir) an‘.
In der 1. Pers. Pl. Präs. und 3. Pers. Pl. Präs. (Mehrzahl) stimmen sie mit
der Standardsprache überein: mir /se kummen ‘wir / sie kommen‘, jelauwen, kochen, lauwen, maanen, rowen,
sammelen, wanderen. „Zwai Punkte fählen inne noch“ (‘Zwei Punkte fehlen ihnen noch.‘)
In der Literatur findet
sich auch die Variante der Präsensform der 1. Pers. Sg. Präs., 1. Pers. Pl. Präs. und 3. Pers. Pl. Präs. ohne
–n, also nur auf –e: „On kumme, korz oda lang, esch an da Himmelspoat an, wäre bäim Petrus esch klaare“ (‘Und
komme, kurz oder lang, ich an der Himmelspforte an, werde beim Petrus ich klagen‘)
, „Mir fäire Faasenaacht en
Maye“ ‘Wir feiern Fasnacht in Mayen‘, „esch singe doch mäi Leed“ (‘Ich singe doch mein Lied.‘)
. Das Gleiche
gilt für werden und tun: ésch weren / mir weren (oder: ésch were / mir were ‘ich werde / wir werden‘ bzw. ésch
doon / mir doon ‘ich tue / wir tun‘.
Das ‘t‘, das die Standardsprache in der 2. Pers. Sg. Präs. am Ende hat, ‘du kochst, rufst, hast, tust, wirst‘,
lässt der Mayener wieder weg, also de kochs, rööfs, has, daas, wüürs. Die 3. Pers. Sg. Präs. endet ganz „normal“
auf ‘t‘, z. B. e kocht – ‘er kocht‘, e rööft ‘er ruft‘, e hat ‘er hat‘, e daat ‘er tut‘, e wüürd ‘er wird‘. Eine
Ausnahme ist sein: e és ‘er ist‘.
Die 2. Pers. Pl. Präs. lautet wie in der Standardsprache, z. B. (d)ihr kocht - ihr kocht, (d)ihr rooft - ihr
ruft, (d)ihr säid – ihr seid, (d)ihr ha’t – ihr habt, (d)ihr doot – ihr tut.
Die Modalverben d´örwe ‘dürfen‘, k´önne ‘können‘, mööse ‘müssen‘, s´ölle ‘sollen‘, w´ölle ‘wollen‘ und möje
‘mögen‘ verhalten sich wie die der Standardsprache: ésch darf, kann, mooß, sóll (s´öll/ sall), wéll und maach
‘mag‘ (recht selten).
Außer den abweichenden Endungen gibt es bei den starken Verben mitunter auch Vokalwechsel in der Stammsilbe.
Dadurch unterscheiden sich die Flexionsformen z. T. erheblich von der Standardsprache und sind für
Nicht-Mayener-Platt-Sprecher kaum zu erlernen. So stehen im Infinitiv und den Präsensformen von gehen einem
Vokal in der Standardsprache in Mayen drei gegenüber (und ein Unterschied der Vokallänge): jòhn (‘gehen‘), ésch
jinn, dau jahs, e jaht, mir jinn, ihr jiht, se jinn.
Auch das Mittelwort der Vergangenheit, das Partizip Perfekt, vieler starker standardsprachlicher Verben ist im
Mayener Platt schwach: In Mayen wird jeschlòft – ‘geschlafen‘, jeschreit – ‘geschrien‘, jelòòst – ‘gelassen‘,
jewòòcht – ‘gewagt (zu (ab)wiegen) = gewogen‘, jew`öscht – ‘gewäscht = gewaschen‘, jebackt – ‘gebackt‘ und man
ist jewääst – ‘gewesen‘. Korrekt ist im Mayener Platt also: Se hat däine Pullover at jew`öscht (‘Sie hat deinen
Pullover schon gewäscht‘) und Ésch hammésch jésder jewòòcht (‘Ich habe micht gestern gewagt (=gewogen)‘
und
Mäi Módder hat de Koore at jebackt (‘Meine Mutter hat den Kuchen schon gebackt‘).
Bei etlichen Verben hat das Partizip Perfekt im Mayener Platt noch die Form älterer Sprachstufen ohne die
Vorsilbe ge-: starke Verben ohne ge- sind z. B. pliewe –‘geblieben‘, jääs – ‘gegessen‘, jange – ‘gegangen‘,
jénn – ‘gegeben‘, kumme – ‘gekommen‘, praacht – ‘gebracht‘, funne – ‘gefunden‘, wuure –‘geworden‘
. Seltener
sind schwache verben ohne ge-: kauft - ‘gekauft‘ (Ésch hann Krómbere kauft).
Alte Formen hat das Platt auch bewahrt, wo die Standardsprache das Partizip Perfekt auf –et bildet (gerechnet,
geatmet). Die Mayener Formen für das Präsens(!) und das Partizip Perfekt e reschent /jereschent und e òòdemt
/jeòòdemt
entsprechen noch dem mittelalterlichen Sprachstand
: Ésch reschenen/ òòdemen, dau reschens / òòdems,
e reschent / òòdemt, mir reschenen / òòdemen, ihr reschent / òòdemt, se reschenen / òòdemen.
Noch seltener als die Vergangenheitsform ist in mitteldeutschen Dialekten der Erhalt der Möglichkeitsform mit
vom Indikativ unterscheidbaren Formen. Beispiele mit Erhalt des Konjunktiv II (Irrealis) sind sähsch(t) ‘sähe‘,
meesch(t) ‘machte‘, leeß(t) ‘ließe‘, kääm(t) ‘käme’, jääf(t) ‘gäbe‘ und schlöösch(t) ‘schlüge‘. E meesch et
leewer morje Nommendaach. ‘Er machte es lieber morgen Nachmittag.‘ Ésch leeßt en nét allaan. ‘Ich ließe ihn
nicht allein.‘ E s`ö`öt, e kääm de nächst Wóch. ‘Er sagt, er käme (die) nächste Woche.‘ Ésch jääft em nét dee
Schäär én de Hand. ‘Ich gäbe ihm nicht die Schere in die Hand.‘ It schlöösch(t) en et leefst dórsch Sunn ón
Mònd. ‘Am liebsten würde sie ihn vermöbeln. Wörtl.: Es schlüge ihn es liebst durch Sonne und Mond.‘ ‘Wenn et
könnt, jööng et haam ‘Wenn es (=sie) könnte, ginge es heim‘. Ma hann jedaacht, et stööng da besser. ‘Wir haben
gedacht, es stünde dir besser.‘ Als Indiz dafür, dass auch in Mayen diese Art der Konjunktivbildung im Abbau
begriffen ist, kann die Formvariation angesehen werden. So stehen sich bei gehen die Formen jööng(t) und jeeng
(t) ‘ginge‘ gegenüber, bei stehen die Formen stööng(t) und steeng(t) ‘stünde‘. Außer durch den von der
Standardsprache verschiedenen Stammsilbenvokal zeichnen sich die älteren Formen durch die Endung –t in der 1.
und 3. Pers. Sg. aus.
Der Konjunktiv wird wie in der Standardsprache gebraucht: Ésch wär‘ fruh, ... ‘Ich wäre froh, wenn ..., Ésch
hätt jär .... ‘Ich hätte gerne ...‘. Wenn et k´önnt/d´örft/w´öllt/möößt, jööng(t) et haam. ‘Wenn es (=sie)
könnte / dürfte / wollte / müsste, ginge es heim‘. Hätt ésch nau aaner! ‘Hätte ich (doch nur) jemanden, der
...; wörtl. Hätte ich nun einen (eigtl.: einer)!‘ Wie in der Standardsprache ist auch im Platt die Umschreibung
des Konjunktivs durch Verb + Hilfsverb die üblichere Konstruktion, wobei dem Hilfsverb ‘werden‘ im Dialekt doon
‘tun‘ entspricht, z. B. Ésch däät hinjòhn ‘‘ch würde (dort) hingehen; wörtl.: ich täte hingehen.‘ und Ésch
dääden et leefst dórsch Sunn ón Mònd schlòòn! ‘Ich würde ihn am liebsten verprügeln. Wörtl. Ich täte ihn es
liebst durch Sonne und Mond schlagen.‘ .
So, wie man die Befehlsform der starken Verben zunehmend in der Umgangssprache hört, ist sie, anders als in der Standardsprache, im Mayener Platt korrekt, nämlich ääß (‘esse‘), lääs (‘lese‘), jéf (‘gebe‘), frääß (‘fresse‘), määss (‘messe‘), seesch (‘sehe‘) etc. Es heißt im Platt tatsächlich nicht ‘iss, lies, gib‘. Die Form des Imperativs richtet sich nach dem Stammvokal des Infinitivs. Bei einigen Verben sind Stammvokal und Vokal des Imperativs unterschiedlich: Zu stòhn (‘stehen‘) heißt es stand, im Plural stieht, zu jòhn (‘gehen‘) jangk, im Plural jieht, zu tròòn (‘tragen‘) traach, im Plural trieht, zu schlòòn (‘schlagen‘) schlaach, im Plural schlieht. Der Imperativ von ‘sein‘ hat die Singularform bés (’bist‘), also bés prav, nicht: sei brav! Die Pluralform ist säid praf (‘seid brav‘).
Eine Besonderheit des Mayener Platts im Vergleich zu anderen mittel- und oberdeutschen Dialekten ist der
teilweise Präteritumserhalt, d. h., es gibt noch Vergangenheitsformen. Während in den oberdeutschen Dialekten
das Präteritum fast vollständig durch das Perfekt verdrängt wurde, hat Mayen bei Hilfsverben, modalen
Hilfsverben und verschiedenen starken Verben (z. B. gehen, sehen, kommen …) nach wie vor eigene
Präteritalformen. Bei den starken Verben sind sie wie in der Standardsprache durch den Vokalwechsel in der
Stammsilbe gekennzeichnet: fleeje (‘fliegen‘) – flooch ‘flog‘, jeeße (‘gießen‘) – jóß ‘goss‘, läie ‘liegen‘
– lòòch ‘lag‘ usw.
Die Personenendungen sind wie die in der Standardsprache, mit Ausnahme der 2. Pers. Sg.,
wo das Mayener Platt auch hier kein –t aufweist: riefst gegenüber reefs. Es gibt auch eine gemischte
Konjugation, z. B. bei ‘machen‘ Hier wird das Präteritum stark gebildet: ésch meesch ‘ich machte‘, e mooch /
e meesch ‘er machte‘, das Partizip aber schwach: jemaacht.
Das Präteritum, das die Standardsprache auch bei den schwachen Verben kennt, z. B. putzte, und das durch die
Endung –te gekennzeichnet ist, gibt es im Mayener Platt nicht. Für die 1. und 3. Pers. Sg. müsste die Form
wegen des Abfalls des Endsilben-e
*bótzt lauten: *ésch bótzt bzw. *e bótzt. Für die 3. Pers. Sg. wäre diese
Form identisch mit der Gegenwartsform e bótzt ‘er putzt‘, d. h., die Präteritumform wäre nicht mehr als solche
markiert und vom Präsens nicht unterscheidbar. Üblicherweise wird stattdessen wie in der Standardsprache das
Perfekt, die vollendete Gegenwart, gebraucht - also Ésch hann jebótzt ‘Ich habe geputzt‘ bzw. E hat jebótzt.
‘Er hat geputzt.‘ Der Gebrauch des Präteritums ist zwar selten, aber z. B. heißt es vom wiedergefundenen
Schlüssel E lòòch ó’m Schrank. (‘Er lag auf dem Schrank.‘), Dee Schoh stoongen /steengen ém Wohnzémmer.
(‘Die Schuhe standen im Wohnzimmer.‘) Auch bei Jésda sòòß de Andreas ém Dajöh. ‘Gestern saß Andreas im Dajöh
(= ein Mayener Lokal).‘ ist die Vergangenheitsform gebräuchlich und korrekt
. Ésch wòr ‘ich war‘ und ésch hatt‘
‘ich hatte‘ sind ebenso wie ésch sóllt, mooßt, wóllt, dórft, kónnt fahre die normalerweise gebrauchten Formen.
Das Futur spielt im Mayener Platt eher eine geringe Rolle. Im Allgemeinen wird zukünftiges Geschehen wie auch beim mündlichen Gebrauch der Standardsprache und in der Umgangssprache durch das Präsens (die Gegenwartsform) ausgedrückt: E kütt morje bäi mésch. ‘Er besucht mich morgen‘; wörtl. Er kommt morgen bei mich. E käuft sésch nächstjohr e neu Auto. ‘Er kauft sich nächstes Jahr ein neues Auto.‘ Die Formen des Futurs sind aber komplett zu bilden und bei Hilfs- und Modalverben werden sie auch gebraucht. Äußerungen wie Dat würs de doch wóll ze köhn säin! ‘Das wirst du dich doch wohl trauen! Wörtl. Das wirst du doch wohl zu kühn sein!‘ und Dat weren ésch doch wóll noch dürwe? ‘Das werde ich doch wohl noch dürfen?‘ oder Nächstjòhr wür en dat Haus doch wóll jebaut hann. ‘Nächstes Jahr wird er das Haus doch wohl gebaut haben.‘ und Se weren haamjelóff säin ‘Sie werden (wohl) heimgelaufen (=gegangen) sein.‘ sind durchaus gebräuchlich. Ebenfalls: Da würs de désch awer noch schwer wunnere! ‘Da wirst du dich aber noch schwer (=sehr) wundern.‘ Auch gedroht werden kann im Futur: Ésch wäären da jeläisch helwe! ‘Hör auf damit! Lass das bleiben! wörtl.: Ich werde dir gleich helfen!‘ Auch eine Futurbildung mit geben ist im Mayener Platt zu finden, wenn auch spärlich: So heißt es etwa Et jét Wénder. ‘Es wird (gibt) Winter.‘ Et jét Fr´öhjohr. ‘Es wird (gibt) Frühjahr.‘ und Et jét kaa Wääder ‘Es gibt kein gutes Wetter.‘ sowie Dat lòh jét neust. ‘Das, was du da tust, klappt nicht‘ wörtl.: Das allda wird nichts‘.
Das Mayener Platt kennt auch das Plusquamperfekt (vollendete Vergangenheit), etwa Ma hadden at jääß. ‘Wir hatten schon gegessen.‘ und darüber hinaus sogar das doppeltes Perfekt (doppelte vollendete Gegenwart) Ma hann at jääß jehat, bee .... ‘Wir haben schon gegessen gehabt, wie (=als) ...‘ und ein doppeltes Plusquamperfekt (doppelte vollendete Vergangenheit) Ma hadden at jääß jehat, bee .... ‘Wir hatten schon gegessen gehabt, wie (=als) ...‘. Ésch hann /hatt dat neulésch schunn jelääse jehat. ‘Ich habe/ hatte das neulich schon gelesen gehabt.‘
Se säin séjat widder am tisbedeere! ‘Sie streiten schon wieder. Wörtl.: Sie sind sich all wieder am disputieren.
‘Nur, wäil der sésch ümmer suu anjét! ‘Wörtl.: Nur, weil der sich immer so angibt!‘ Wenn en séjewäile nét
schéckt, kann en séjawer kraddeleere. ‘Wenn er jetzt nicht gehorcht, bekommt er richtig Ärger. Wörtl.: Wenn
ihn [sic!] sich alleweil nicht schickt, kann ihn [sic!] sich aber gratulieren!‘ Gar nicht selten sind Verben,
die im Gegensatz zu ihren hochdeutschen Entsprechungen reflexiv gebraucht werden, z. B. sich angeben: De Peder
jét sésch ümmer suu an. Wörtl. ‘Der Peter gibt sich immer so an; ist ein Angeber.‘ Sich disputieren ist einfach
‘streiten‘. Wenn se sésch zertädéje ‘sich zerdädigen‘, sind sie handgreiflich geworden und prügeln sich. Der
reflexive Gebrauch von ‘gratulieren‘ ist eine Drohung oder Ankündigung von etwas Unangenehmem: Da kannsde désch
awer kraddeleere!
‘Dann (er)geht es dir aber schlecht; wörtl.: Dann kannst du dich aber gratulieren!‘ Sich
behusten (übertr.): Sagt man zu jemandem Behoost désch! ‘Behuste dich!‘, weist man dessen Kritik verächtlich ab.
(Vermutlich ist das heute nicht mehr zu hören.) Wenn bemerkt wird, dass man sésch goot jesäänt hat, hat man
sich eine (zu) gehörige Portion von etwas genommen: sich segnen – „sich s. seinen Teil von einer Sache in allzu
grossem Masse nehmen“ (RHEIN. 8, 16)., sich schicken bedeutet ‘gehorchen und auch: sich betragen‘: Nau maach ón
schéck désch! ‘Nun benimm dich / sei folgsam.‘ als Ermahnung für das Kind, wenn es z. B. zu jemand zu Besuch
geht, wörtlich: ‘Nun mache und schicke dich!‘ Weitere Beispiele sind: Sich bekotzen - hier: ‘nicht: auf etwas
erbrechen, nur: erbrechen‘: E hat sésch baal bekotzt. ‘Er hat beinahe erbrochen; wörtl. Er hat sich bald
bekotzt‘, sich darmachen - ‘etwas so einteilen, dass das Vorhandene ausreicht‘, etwa: Ma maaren us dòòr.
Wörtl.: ‘Wir machen uns dar.‘, sich finden ‘sich wieder beruhigen, „runterkommen“: Nau finndésch! ‘Jetzt finde
dich!‘, sich loslassen ‘nicht mit etwas geizen, sich großzügig verhalten‘, z. B. Dòò hasde désch awer
lossjelòòßt! ‘Da hast du aber ein großes Geschenk gemacht!‘, sich regieren (ausgestorben?) 'sich waschen,
pflegen, kämmen, die Kleider ordnen etc.', z. B. in der Aufforderung: Rejeer déaas! ‘Regiere dich mal!‘,
sich schuckern ‘erzittern, weil man fröstelt‘, sich versprechen hier: „ein Gelübde machen: sech v. eppes ze
dun.“ (LOTHWB. 1, 153b), scherzhaft, wenn man z. B. unbequem kniet, die Haare komisch frisiert hat, seltsam
angezogen ist, ...: Has dau désch suu verspróch? ‘Willst du das nicht ändern? Soll das so sein? Wörtl.: Hast
du dich so versprochen (meint: Hast du ein Gelübde abgelegt)?‘. Sich vertragen bedeutet ‘etwas zu Schweres
tragen‘ und wird gern scherzhaft oder ironisch gebraucht, z. B. bei etwas Leichtem: Vertraach désch nét! Die
standardsprachliche Bedeutung ‘miteinander auskommen‘ kennt das Mayener Platt nicht.
Auch für die Verben ‘essen‘ und ‘trinken‘ gibt es im Mayener Platt eine Reflexivkonstruktion, die die
Standardsprache nicht kennt: Ésch hamma jerat e Prüütsche jääß. ‘Ich habe mir gerade ein Brötchen gegessen.‘
E és sésch e Beer tréngge. ‘Er ist sich ein Bier trinken.‘
Vorsilben von Verben sind im Mayener Platt manchmal von denen in der Standardsprache verschieden. Der Mayener kann sich verschrecken – ‘erschrecken‘, verkälten – ‘erkälten‘ (Ésch hammésch verkält.), verstricken – ‘ ersticken an etwas‘ (E és baal verstréckt.) und etwas verzählen – ‘erzählen‘. Ver- heißt es bei verbatscheln – ‘etwas ausplaudern, sich verplappern‘ (Verbatschel désch nur jòò nét!), verbirtseln – ‘vergehen vor Ungeduld‘ (Ma säin baal verbiertselt!), verfumfeien (ausgestorben?) – ‘eine Sache vermasseln‘ (E haddet verfómfeit!), vergaddern – “eine zu grosse [sic!] Menge unterbringen“ (Bo wéllsde dat daa all verjaadere?), verhausen – ‘etwas verlegen‘ (Ber hat mäine Schl´ösl verhaust?). Verstärkend, gerade vielfach bei Mundartverben, wird das Präfix zer- gebraucht, das „etwas Zerteilen“ ausdrückt: zerschlagen – hier: ‘schlagen, prügeln‘, zerflazen – ‘prügeln‘, zernennen – ‘mit Schimpfnamen belegen‘, zerschänden – ’heftig beschimpfen, ausschimpfen‘.
Mit dem Passiv wird ausgedrückt, (mit) wem etwas geschieht, z. B. E würd jefahre. ‘Er wird gefahren.‘ Ésch weren aafjehólt. ‘Ich werde abgeholt.‘ Außer dem Passiv, das mit ‘werden‘ gebildet wird, gibt es in der Standardsprache ein Passiv mit ‘bekommen‘. Da der Mayener aber nichts bekommt, sondern nur kriegt, heißt es z. B. E krischt de Hòòr jest´ömpt ‘Er kriegt die Haare geschnitten (wörtl. gestümpt, d. h. gestutzt)‘, E krischt e Booch jeschenkt. ‘Er kriegt ein Buch geschenkt‘ und Se hat e Jüngelsche krischt. ‘Sie hat einen Sohn bekommen.‘ Die Verwendung ist häufig und wird auch in die Umgangssprache übernommen. Es gibt aber auch passivische Anwendungen, die m. W. nur im Platt vorkommen, z. B. Ésch hann kaa Zäit krischt. ‘Ich habe keine Zeit (dafür) gefunden. Wörtl. Ich habe keine Zeit gekriegt.‘, Dau kriss noch Spass. ‘Du kriegst noch eine unangenehme Überraschung.‘ E krischt de Kiehr nét. ‘Er kriegt die Kurve nicht (vor lauter Arbeit).‘, Der krischt noch Jeld eraus! ‘Obwohl er im Unrecht ist, wird er noch frech. Wörtl.: Der kriegt noch Geld heraus.‘ oder auch: Ber et längst lääft, krischt K´ölle métsamt em Dom! ‘Wörtl.: Wer es längst lebt, kriegt Köln mitsamt dem Dom!‘ Statt ‘werden‘ in dem auch im Hochdeutschen korrekten Passivsatz ‘Er wird gerufen.‘ E würd jerooft. kann es im Mayener Platt auch kriegen heißen: E krischt jerooft. ‘Er kriegt geruft (= gerufen).‘ ‘Kriegen‘ heißt es auch bei E krischt jesunge. ‘Er kriegt (ein Ständchen) gesungen.‘, E krischt jewinkt. ‘Er kriegt gewinkt.‘ und E krischt jekünnéscht ‘Er kriegt gekündigt.‘ Diese sind ebenfalls nur im Platt korrekt. Standardsprachlich müsste es wohl ‘Ihm wird gesungen‘, ‘Ihm wird gewinkt.‘ und ‘Ihm wird gekündigt.‘ heißen. In Mayen ‘kriegt man gratuliert‘: Dau kriss óf de Namensdaach kraddeleert. ‘Du kriegst auf den Namenstag gratuliert.‘, d. h. standardsprachlich, ‘Dir wird zum Namenstag gratuliert.‘ Auch heißt es Dat hadden su jeliehrt krischt. ‘Das hat er so gelehrt (ge)kriegt. Das hat man ihn so gelehrt.‘ Verschiedene (An)drohungen erfolgen ebenfalls mit ‘kriegen‘: Dau kriss aan jeträäde. ‘‘Du kriegst eine getreten.‘ Mit Dau krisse / e krischt se jej`ö`ökt. ‘Du kriegst sie / er kriegt sie gejäukt (= geschlagen) (vgl. RHEIN. 9, 553 und RHEIN. 4, 1501, h) wird heftige Prügel angekündigt, genau so, wie mit Dau kriss Réss! ‘Du kriegst Risse.‘ Es geht aber noch sparsamer: Waat! Dau krisse! ‘Warte! Du kriegst sie!‘
Gelegentlich verlangt ein Verb im Mayener Platt einen anderen Kasus (Fall) als in der Standardsprache: So heißt (bzw. eher: hieß) es: Roof ma an, wenns de dòò bés! ‘Ruf mir an, wenn du da bist!‘, Et rööft da aaner! ‘Es ruft dir einer!‘ und Ésch kraddeleeren désch óf däine Jeburtsdaach! ‘Ich gratuliere dich auf deinen Geburtstag!‘
Das Mayener Platt kann etwas, das die Standardsprache nicht kann. Anders als die Standardsprache, hat das
Mayener Platt die Möglichkeit, mit der Konstruktion sein + am + Infinitiv eine Tätigkeit, eine Handlung, die im
Augenblick des Sprechens stattfindet oder zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit, von dem berichtet wird,
stattgefunden hat, besonders hervorzuheben.
In der Schule gerügt mit „am Katz am Schwanz am raus am ziehen“ ist
sie doch im Platt d i e Form, aktuelles Geschehen, aktuelle Vorgänge auszudrücken. Will man hervorheben, dass Oma
gerade im Moment am Herd steht und kocht, will man sozusagen auf die Frage, was Oma aktuell tut, antworten, heißt
es immer De Oma és am koche. ‘Oma ist am kochen.‘ Verstärkend wird gern ein gerade hinzugefügt: De Oma és jerat am
koche. ‘Oma ist gerade am kochen.‘De Oma kocht ist dagegen eine reine Feststellung - sie macht das gerade /
üblicherweise / heute / manchmal / morgen -, die man auch machen kann, wenn Oma gar nicht da ist. Diese Aussage ist,
im Vergleich mit Rheinischen Verlaufsform, statisch
und nur ein „Standbild“, während am koche dynamisch,
„ein Film“ ist, was auch die Bezeichnung Rheinische V e r l a u f sform andeutet. Die Rheinische Verlaufsform wird
nicht nur in der Gegenwartsform, sondern auch in den Vergangenheitsformen gebraucht: De Oma wòr am koche. ‘Oma war
am kochen.‘ Ésch wòr jesder jerat am koche, bee en an da Dür jeschellt hat. ‘Ich war gestern gerade am kochen, wie
er (wörtl.: ihn) an der Tür geschellt hat.‘ Ebenso kann das Perfekt, die vollendete Gegenwart, gebraucht werden: De
Oma és jerat am koche jewääst, bee en haam kòòmt. ‘Oma ist gerade am kochen gewesen, wie er (wörtl.: ihn) heim kam.‘
Ma säin jerat am ääse jewääst, bee en anjerooft hat. ‘Wir sind gerade am essen gewesen, wie er angerufen hat.‘ Im
Plusquamperfekt, der vollendeten Vergangenheit, heißt es: De Oma wòr jerat am koche jewääst, bee en haam kòòmt.
‘Oma war gerade am kochen gewesen, wie er (wörtl.: ihn) heim kam.‘ Ma wòòren jerat am ääse jewääst, bee en anjerooft
hat. ‘Wir waren gerade am essen gewesen, wie er angerufen hat.‘
Futur ist in Fällen wie Ésch wäären dann am schlòòwe säin. ‘Ich werde dann am schlafen sein.‘ theoretisch
möglich. In dem Sinn aber wie im englischen present progressive nicht: I am going to Mainz this weekend. *‘Ich
bin am Wochenende nach Mainz am fahren (wörtl.: gehen)‘. Obwohl Ésch säin am lääse. normaler Gebrauch der
Rheinischen Verlaufsform ist, ist Ésch säin heude Òòmend e Booch am lääse. *Ich bin heute Abend ein Buch am
lesen.‘ nicht möglich
Möglich ist es aber auch, mit der Rheinischen Verlaufsform eine Art von „Dauerzustand“ auszudrücken: Der és noch
am studeere. ‘Er studiert noch.‘ Der és am schaffe. ‘Er arbeitet, verdient Geld.‘
Die Rheinische Verlaufsform funktioniert auch, wenn ein Akkusativobjekt hinzutritt: De Oma és am Krómbere koche.
‘Oma ist am Kartoffeln (wörtl.: Grundbirnen) kochen‘. Ésch säin at am D´ösch degge. ‘Ich bin (wörtl.: sein)
schon am Tisch decken.‘ Der és jarat am Zäidung lääse. ‘Er ist gerade am Zeitung lesen.‘ Et és am Fisdere bótze.
‘Sie (wörtl.: Es) ist am Fenstern [Plural] putzen.‘ Ésch säin am Bedder maare. ‘Ich bin (wörtl.: sein) am Betten
machen‘. Ésch säin am Plätzjer bagge. ‘Ich bin (wörtl.: sein) am Plätzchen backen‘. Die Form, bei der das
Objekt (‘die Plätzchen‘) zwischen am und das Prädikat tritt, ist die ältere, (zumindest früher) geläufigere:
Krómbere koche, Zäidung lääse, Fisdere bótze, Bedder maare, Plätzjer bagge werden als Einheit empfunden und
müss(t)en zu *plätzjerbagge ‘*plätzchenbacken‘, *fisderebótze ‘*fensterenputzen‘, *beddermaare ‘*bettenmachen‘,
*zäidunglääse ‘*zeitunglesen‘usw. werden. Die Stellung De Oba és jerat de Stròòß am kehre. ‘Opa ist gerade die
Straße am kehren‘ ist auch möglich. Das gilt auch für die obigen Beispiele. Bei einem bestimmten Objekt Bésde e
Klaad am nähe? ‘Bist du dir ein Kleid am nähen?‘ E és (sésch) jerat e St´öck am ääse. ‘Er ist (sich) gerade ein
Stück (=Butterbrot) am essen.‘ ist nur diese Stellung möglich: *E és sésch am e St´öck ääse. ist ungrammatisch
und falsch. Zumindest eine Ausnahme gibt es aber, doch ändert sich durch die Umstellung die Bedeutung: Ma säin
jerat am kawwietréngge. heißt ‘Wir frühstücken gerade. Wörtl. Wir sind (wörtl. sein) gerade am Kaffee trinken.‘
und, z. B. nachmittags, heißt es Ma säin en Tass Kawwie am tréngge.
‘Wir sind (wörtl. sein) eine Tasse Kaffee
am trinken.‘
Es können nicht alle Verben die Rheinische Verlaufsform bilden. Solche, denen der Aspekt des Handelns fehlt, oder
solche, die keine Dauer ausdrücken, können keine Rheinische Verlaufsform bilden. Hierzu gehören sehen, hören,
sitzen, liegen, stehen. Dies ist ein großer Unterschied zur englischen Verlaufsform, wo auch gerade Verben wie
to see (I’m seeing), to sit (I’m sitting), to stand (I’m standing) diese bilden. Nicht möglich sind*Ésch säin
en am sehe. *‘Ich bin (wörtl.: sein) ihn am sehen.‘, *E és e Plöömsche am sehe. *‘Er ist ein Blümchen am sehen.‘
oder *Ésch säin en am hüüre. *‘Ich bin ihn am hören.‘ sowie *E és e Vüülsche am hüüre. *‘Er ist ein Vögelchen
am hören.‘ Hier heißt es nur Ésch sehn en. ‘Ich sehe ihn.‘ E säiht e Plöömsche. ‘Er sieht ein Blümchen.‘, Ésch
hüren en. ‘Ich höre ihn.‘ und E hüürt e Vüülsche. ‘Er hört ein Vögelchen.‘ Auch *E wòr ó’m Stohl am sétze. *‘Er
war auf einem Stuhl am sitzen.‘ *E wòr ém Flur am stòhn. *‘Er war im Flur am stehen.‘ *E wòr ém Bett am läie.
*‘Er war im Bett am liegen.‘ sind ungrammatisch und nicht möglich. Auch Verben, die ein Handeln, Tun ausdrücken,
das nur kurze Zeit dauert, wie sagen, holen, bringen, stellen, legen, setzen, können keine Rheinische
Verlaufsform bilden. Es heißt nicht *E és en Taplett am hólle. *‘Er ist eine Tablette am holen (= nehmen).‘,
sondern E h´öllt en Taplett. Auch *Se és sésch am lääje / stelle / setze…. *‘Sie ist sich am legen /stellen /
setzen.‘ ist nicht korrekt. Dagegen ist E és am Fernseh kugge. ‘Er ist am Fernseh gucken.‘, was ja länger
dauert, üblich. Bei zusammengesetzten Verben sieht es anders aus: Se wòr sésch jerat am hinlääje, bee de Tant
Mariesche kòòmt. ‘Sie war sich gerade am hinlegen, wie die Tante Mariechen kam.‘ Dee wòòren jerat am fottfahre.
‘Sie waren im Begriff fortzufahren (wörtl. die waren gerade am fortfahren).‘ Ésch säin jerat am aafhólle. ‘Ich
bin (wörtl. sein) gerade am abholen (=abnehmen).‘ Hinlegen, fortfahren und abholen dauern eben länger.
Bei Modalverben (müssen, sollen, wollen, können, mögen, dürfen) kann die Rheinische Verlaufsform nicht gebildet
werden. Ebenso geht dies nicht bei z. B. sagen, wissen, meinen, brauchen. *Ma säin am w´össe. *‘Wir sind am
wissen‘. und *Ma säin am praure *‘Wir sind am brauchen.‘ sind ungrammatisch.
Eine andere Art, momentanes Geschehen auszudrücken, die aber selten vorkommt, ist die mit tun: E daat jerat schlòòwe. E daat jerat ääse. Auch grundsätzliche Vorlieben, Gewohnheiten o. Ä. lassen sich mit tun + Infinitiv ausdrücken: Et daat jär nähe ón strégge. ‘Es näht und strickt gern.‘ E daat ómens (ümmer) warm ääse. ‘Er isst normalerweise abends eine warme Mahlzeit; wörtl. Er tut abends (immer) warm essen.‘
- Siehe zu den einzelnen Formen die Konjugationstabellen in Kapitel 19. ↩
- Trotzdem können die Verben auch ohne Endung realisiert werden: ésch jelauwen wird zu schlau1f ‘ich glaube‘ oder ‘schmaanét ‘ich meine nicht‘; vgl. auch Wenkersatz Nr. 8 von 1887 „ech jelauv“. ↩
- Was aber nicht geht, ist eine der Umgangssprache ähnliche Form *ésch koch / lauf / roof. ↩
- RITTEL 1998, 36, 43. ↩
- SCHÄFER, 1998, 20. ↩
- RITTEL 1998, 24, 29. ↩
- Siehe auch die Konjugationstabellen in Kapitel 19. ↩
- Im Wörterbuchteil unter wagen I, nicht wiegen. ↩
- Vgl. PAUL 1989, 244, §243. ↩
- Siehe hierzu auch Differenzen bei Vorsilben in diesem Kapitel. ↩
- Das gilt für alle Personen. ↩
- Vgl. PAUL 1989, 260, §265. ↩
- Dääts de dat Pageet für mésch anhólle? ‘Würdest du das Paket für mich annehmen? Wörtl.: Tätest du das Paket für mich anholen?‘ Denn däät ésch médda Knäifzang nét anpagge! ‘Er ist ein schmieriger, schmuddeliger Kerl. Wörtl. Den täte ich mit der Kneifzange nicht anpacken.‘ ↩
- Siehe in Kapitel 19 die Konjugationstabellen für die häufigsten starken Verben. ↩
- Zur Apokope vgl. Kapitel 4. ↩
- Ebenso falsch wie in der Standardsprache wäre der Gebrauch des Präteritums bei: *Ésch jóng heude morje óf de Maat. Es heißt: Ésch säin ... jange. Und: *Ésch probeert heude morje désch/dir anzeroowe. *‘Ich probierte heute Morgen dich /dir anzurufen.‘ anstatt: Ésch hann heude Morje probeert, désch /dir anzeroowe. ‘Ich habe heute Morgen probiert, dich anzurufen.‘ Oder: *Se bauten vürzweijòhr én Ettringe. *‘Sie bauten vor zwei Jahren in Ettringen.‘ (Das Haus steht ja wohl noch!) ↩
- Die schwangere Frau in der Bäckerei: Ésch kreen e Wäißpruut! Verkäuferin: Da wür däine Mann sésch awer schwer wunnere! ↩
- RHEIN. 2, 1367: „da kannste dech gr.! in dem Falle wirst du etwas Unangenehmes erfahren, dann gibt es Strafe; du kannst dich freuen auf die grosse Arbeit, Strafe (ironisch)“. ↩
- Vgl. DWB 10, 1977: „auf etwas, in etwas husten, ausdruck der verachtung“. ↩
- Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lsch_(Sprache)#Sprachliche_Merkmale. ↩
- Rhein. 2, 973, 1a. ↩
- Weitere Beispiele: zerdädigen – ‘sich streiten, handgreiflich werden, sich prügeln‘, zerdängeln – ‘auf seinem Sitzplatz immerfort hin- und her rutschen‘, zerknutschen – ‘verknautschen, knutschen‘, zerzänken – ‘sich heftig zanken‘, zermustern – ’sich geschmacklos durch nicht zusammenpassende Kleidungsstücke kleiden‘. ↩
- Ein paar weitere Beispiele: E krischt aan jeschlòòn. ‘Er bekommt eine geknallt.‘ Wörtl. Er kriegt eine geschlagen. Dau krisaan én de Zänn! Wörtl. ‘Du kiegst eine in die Zähne.‘ Dau krisaan vür de Höör! Wörtl. Du kriegst eine vor die Hörner. E krischt de Höör nét vóll. ‘übertr. Er bekommt den Hals nicht voll. Wörtl. Er kriegt die Hörner nicht voll.‘ ↩
- Zu den Präpositionen vgl. Kapitel 17. ↩
- Die Rheinische Verlaufsform wird im „Mayener Wörterbuch“, da es sich im Gegensatz zum substantivierten Infinitiv um aktuelles Geschehen handelt, klein geschrieben. Auf die semantischen Unterschiede von am + Infinitiv und beim oder zum + Infinitiv kann hier nicht eingegangen werden. ↩
- Das présent progressif im Französischen, das wie die Rheinische Verlaufsform verwendet wird, wenn man gerade etwas tut (être en train de faire qqc.), z. B. Je suis en train de manger ‘Ich bin gerade dabei zu essen ‘, ist m. E. dieser deutlich näher als die engliche Verlaufsform. ↩
- Obwohl ‘kochen‘ ein „Handlungsverb“ ist. ↩
- Wie auch in manchen hessischen Dialekten und im Luxemburgischen. ↩
- Alle Möglichkeiten des Gebrauchs der Rheinischen Verlaufsform können im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden. ↩
9. Substantive
Dee Baach, der Préll, der Faasenaacht; Prämmes, Käulsches, Bòògert; Famillésch; Bäll-, Staan, Hänn; Bedder, Himmer, Kn´öbbele. Von den Formen des Substantivs /Hauptworts
Die Hauptwörter im Mayener Platt weichen z. T. beim Artikel, den Endungen und bei Verkleinerungen von der Standardsprache ab. Eine Reihe Mayener Hauptwörter hat bzw. eher: hatte ein anderes Geschlecht als in der Standardsprache. Die meisten dürfen als veraltet gelten und verschiedene sind wohl völlig außer Gebrauch. Im Mayener Platt sind männlich: Der Beer (veraltet) ‘das Bier‘, Der Mayener Beer és der besde Beer (‘Der Mayener Bier ist der beste Bier.‘), und der Préll (veraltet) ‘die Brille‘, was auf ‘der Beryll‘ zurückgeht, den Halbedelstein, aus dem die ersten Lesehilfen geschliffen wurden, sind vielleicht noch bekannt. Der Dill, ‘die Diele, das Brett‘: „langes, schmales Fußbodenbrett Herkunft mittelhochdeutsch dil[le], althochdeutsch dilla, eigentlich = Boden“ (DUDEN), dürfte mittlerweile von Brett abgelöst worden sein (vgl. auch Diel, RHEIN. 1, 1350). Auch der Faasenacht, also mit maskulinem (männlichem) Artikel, ist ausgestorben. Eventuell von „Fast|nacht, Fas|nacht die letzten sechs Tage umfassender Z e i t r a u m der Fastnachtszeit vor der mit dem Aschermittwoch beginnenden Fastenzeit“ (DUDEN) [Hervorhebung G. D.-S.] abstammend, findet man heute nur noch ‘die Fasnacht‘ oder sogar ‘die Fastnacht‘. Spärlich sind die Belege. In einem Fastnachtslied von heißt es: „Vom eschte Mayena Faasenaacht, do krischt ma nie jenocht.“ In einem anderen „Doch bäi em Faasenaacht em nägsde Johr häi do säin mir dräi bestemmt widda dobäi.“ Es heißt(?) auch der Kérmes. Der Grund dafür, dass es der Kérmes und nicht die Kirmes heißt (oder zumindest: hieß), könnte sein, dass er eher mit der Bedeutung ‘Jahrmarkt‘ als mit ‘Kirchmesse‘ in Verbindung gebracht wird. Während der Kirmes möglicherweise verschwunden ist, ist der Klo nach wie vor im Gebrauch, , obwohl es sich um eine Abkürzung von ‘das Klosett‘ handelt. Anderswo fällt der Mayener damit aber sehr auf. Der Kròòt ‘der Grat‘ hat in der hochdeutschen Standardsprache ‘die Gräte‘ als Gegenstück. Auch der Wachs und der Zinn weichen mit ihrem Artikel von der Standardsprache ab. ‘Der Bach‘ hat im Mayener Platt femininen (weiblichen) Artikel: dee Baach: Dee aal Baach ‘die alte Bach‘ ist die Bezeichnung für die Nette, die durch Mayen fließt. Ansonsten dürfte die Bach dem Bach gewichen sein. Auch dee Fister ‘die Fenster‘ für den Singular, also für ein einzelnes Fenster, ist längst nicht mehr üblich. Dee Fister geht auf das lateinische Femininum fenestra, eine Neuerung, die die Römer ins Rheinland brachten und die das germanische Wort das Windloch/Windauge (vgl. engl. window) sachlich und sprachlich ersetzt hat, zurück. Dee Platz, heute nicht mehr gängig, stammt von französisch la place bzw. vom mittellateinischen placea, platea ab und hat entsprechend den femininen Artikel (vgl. RHEIN. 6, 963 Platz III). Dee Schlòòt (veraltet) ‘Salat‘ oder auch der Salat sind beides Mayener Formen. Den sächlichen Artikel hat im Mayener Platt ‘die Backe‘, nämlich dat Back ‘das Back‘ und ma schlaht aanem aan vür’t Back ‘man schlägt einem eine vor das Back‘. Dat Pläistéft ‘das Bleistift‘, das heute gewiss kaum mehr bekannt ist, und dat Schérm ‘das Schirm’ haben mittlerweile den standardsprachlichen Artikel ‘der‘ angenommen. Bei Pony ‘kleine Pferderasse‘ und Pony ‘in die Stirn gekämmtes kurz geschnittenes Haar‘ ist (zumindest: war) der Artikel gleich: das Pony. Dat Eck ‘das Eck‘ und dee Eck ‘die Ecke‘ sind wohl beide noch im Gebrauch, wobei dat Eck evtl. mehr heraustretende Teile an Gegenständen und Gebäuden meint und dee Eck etwa eine im Zimmer, in die man etwas stellt (vgl. RHEIN. 2, 6). Auch das Cola, das man sich früher bestellt hat, gibt es kaum mehr - und das Limo ebensowenig: Ésch kreen e Cola / e Limo.
Neben den Substantivendungen, die es in der Standardsprache gibt, hat das Mayener Platt eigene. Besonders
häufig und bei Wörtern verschiedenster Herkunft findet sich die Endung –es. Dazu gehören mit sächlichem
Artikel, Wörter wie z. B. dat Bajes (‘kleines, verfallenes Häuschen‘), dat Lämmes (‘einfältiger Mann‘), dat
Pläiwes (‘Bleibens, keinen Ort, wo man zuhause ist‘), die einfach diese Form haben, aber auch solche, die durch
Sandhi vereinfacht werden wie dat Bagges (‘Backhaus‘), dat Ròòdes (‘Rathaus‘). Häufiger haben sie männlichen
Artikel: Dalles (‘Erkältung‘), Mackes (‘Kraft‘), Zores (‘Gezänke, Uneinigkeit, Streit‘) (jiddischer bzw.
hebräischer Herkunft), Hósbes (‘Freund, Bräutigam; Mann‘), Kappes (‘Kohl‘), Sadornes (‘sadistisch veranlagter
Mann oder Junge‘; (lateinische Herkunft: Saturnus). Viele abfällige Bezeichnungen für Männer B´ölles (‘grober,
unsensibler, rücksichtsloser Mann‘), Bulewuuges / Bullenwaukes (‘grober und mit groben Bewegungen sich laut
gebärdender Mann‘), D´ölbes (‘Tölpel, Dummkopf‘), Heules (‘jemand, der immer klagt und jammert‘), Klüßneres
/Kloßneres (‘älterer, langsamer, schwerfälliger Mann‘), Knäules (‘Dickschädel‘), Pr´ölles /Brülles (‘Junge, der
häufig und laut weint). Der Labbes hingegen ist ‘ein gutmütiger Mann‘ oder auch ‘schelmenhaft‘. Wie Kirmes, mit
(zumindest früher) maskulinem Artikel, (‘Kirchmesse, Kirchweihfest‘), Prämmes (‘dicker Knüppel‘), Ulles
(‘(Nacht-)Mütze‘) gibt es etliche weitere Substantive mit dieser Endung. Auch Kurzformen von Männernamen sind
hier häufig zu finden: Funnes (‘Alfons‘), Maddes (‘Matthias‘), Rigges (‘Richard‘). Aus der Verkleinerungsendung
–chen + Genitiv–s ist, je nach vorausgehendem Konsonanten, die Endung -chens [ʃəs] bzw. -jes [jəs] abgeleitet
und häufig bei der Bezeichnung von Kinderspielen zu finden: So wird das Mütterchen bei ‘Mutter und Kind‘
spielen zu M´öddersches [ˈmødɑʃəs] (‘Mütterchens‘). Ebenso gebildet sind Käulsches [ˈkœʏ¹lʃəs] (‘Käulchens‘
ein Klickerspiel, d. h. Murmelspiel), Nòhläufjes [ˈnɔː¹lœʏ²fjəs] (‘Nachläufchens‘ = Fangen), Verstääschjes
(‘Versteckchens‘). Auch bei S`ö`ößjes [zœː¹sjəs] (‘Sößchens‘ = Béchamelkatoffeln) sowie, in den folgenden
Beispielen allerdings in zusammengesetzten Substantiven, bei Markklüüsjessópp [ˈmɑ²ʁəkklʏː¹sjəszop]
(‘Markklößchenssuppe‘), Schössjeskóndidor [ˈʃœsjəsˑko¹ndidɑ] / Schösschenskonditor (ausgestorben) abfällig
‘Bäcker‘ und auch z. B. bei Mädscheslatsch [ˈmɛː¹tʃəslatʃ] (veraltet: ‘Junge, der am liebsten mit Mädchen
spielt‘), Reemschessandale [ˈʁeː¹mʃəsza¹ndaː¹lə] /Riemchenssandalen ‘Riemensandalen‘ und Verzéllschesbóch
[faˈtse²lˑʃəsboː¹x] / Verzählchensbuch (veraltet: ‘Unterhaltungslektüre, Roman‘).
Die männliche Endung –ert zeigt häufig Abschätzigkeit an. Verschiedene Schimpfwörter enden damit: Banggert
/Bankert (‘uneheliches Kind‘), Boogert /Bokert „einfältiger, steifer, tölpelhafter Mensch“, Päudert /Päutert
(‘feister, beleibter Mann‘), Tòòbert /Tapert (‘ungeschickter Mensch‘), G`ö`ögert / Göckert eher scherzhaft
‘Hahn, Gockel (nur das Tier)‘. Auch abgewetzte Kleidungsstücke Schäddert /Schättert (‘abgetragenes
Kleidungsstück‘) und Jäimert [ˈjɛi¹mɑt] / Jeimert ('armseliger, schäbiger Mantel oder armselige, schäbige
Jacke') haben diese Endung. Einige nicht abfällig gebrauchte Wörter Méljert /Milchner (‘männlicher Hering‘) und
Mósdert/ Mostert (‘Senf‘) sowie Straßennamen Buurhausdert / Bornhaustert und Wingert / Weingarten und auch
Bungert ‘Baumgarten’ kommen dazu.
Der auch in der Standardsprache nicht so häufigen Endung –ie für feminine Substantive im Singular entspricht im
Mayener Platt die Endung –ésch [eʃ] in Famillésch [faˈmi¹leʃ] (‘Familie‘), Krannésch [ˈkʁɑ¹neʃ] (‘Geranie‘),
Kastannésch [kɑsˈdɑ¹neʃ] (‘Kastanie‘), Piddersilésch [ˈpidɑzileʃ] (‘Petersilie‘), Kannallésch [kɑˈnɑ¹leʃ]
(‘Kanaille‘), Linnésch [ˈli¹neʃ] (‘Linie‘), Tallésch ‘Taille‘, Prédullésch [ˈpʁe¹duleʃ] ‘Bredouille‘ und
Médallésch [meˈda¹leʃ] ‘Medaille‘. Der Mayener Platt-Endung -ersch (‘-ersche‘) für weibliche Personen, statt
der in der Standardsprache die Endung –in steht, kommt vor bei Nähdersch [ˈnɛː¹daʃ] (veraltet) /Näh(d)ersche
‘Näherin‘, Tóddelersch [ˈtodəlɑʃ] /Tuttelersche ‘Frau, die stottert‘, Fäudelersch [ˈfœy²dəlɑʃ] / Fäutelersche
‘Frau, die beim Spiel schummelt‘, Schw`öjersch [ˈʃvœː¹jɑʃ] / Schwägersche ‘Schwägerin‘, Zijeunersch
[tsi¹ˈjœʏ¹naʃ] / Zigeunersche ‘Zigeunerin‘ und Haushäldersch /Haushältersche ‘Haushälterin‘.
Substantive, die Einzelteile zusammenfassen, enden auf -s Andons/Antuns ‘Gesamtheit der Kleidung‘, Énjemaachs
‘Eingemachtes‘, Jehacks / Gehacktes ‘Hackfleisch‘, Jekochs ‘Gekochtes‘, Jeschradels / Geschratels ‘Lärm lauter
Stimmen‘, Jedöns / Getüne ‘Getue‘, Jeb´öndels / Gebündels ‘Gesamtheit von Bündeln oder Gepäckstücken',
Jeschnüdels / Geschnüdels 'das verächtlich überhebliche Bemängeln, Bekritteln, abfälliges oberflächliches
Urteilen' etc. und auch kurze Wörter wie Hicks / Schlicks ‘Schluckauf‘, Kräcks ‘Erkältung‘, Speeks / Spieks
‘Spucke‘ enden auf –s. Schnaps und Schlips gehören laut DUDEN der Umgangssprache an. Besonders gern lässt der
Mayener aber auch bei Substantiven das ‘e‘ am Schluss weg: Tösch ‘Tasche‘, Kérresch ‘Kirche‘, Aff ‘Affe‘, Ameis
‘Ameise‘, Duus ‘Dose‘, Eul ‘Eule‘, Flasch ‘Flasche‘, Herd ‘Herde‘, Naas ‘Nase‘, Perl ‘Perle‘ usw.
Nicht nur beim Singular (Einzahl), sondern auch beim Plural (Mehrzahl) gibt es unterschiedliche
Substantivendungen in Platt und Standardsprache. Die von der Standardsprache abweichenden Pluralbildungen haben
entweder „0-Endung“ oder –er, -scher, –jer, –e, -len, -ren.
Da die standardsprachliche Pluralendung -e sehr häufig ist, kommt im Platt die „0-Endung“, die durch Apokope
(Wegfall der Endung) entsteht, ebenfalls oft vor, unter Beibehaltung des Umlauts: B`ö`ört- ‘Bärte‘, Bäll-
‘Bälle‘, Hööt- ‘Hüte‘, Bäum- ‘Bäume‘, Kränz- ‘Kränze‘, N`öht- ‘Nähte‘, Kr´ötz- eher scherzhaft ‘freche, kleine
Kinder‘ (zu Grutz), oder des Vokals: Deer ‘Tier‘ - Deer- ‘Tiere‘, Baan ‘Bein‘ - Baan- ‘Beine‘, Staa2n ‘Stein‘
(Tonakzent 2) – Staa1n- ‘Steine‘ (Tonakzent 1).
Eine andere Art von „0-Endung“ haben die sogenannten subtraktiven Pluralformen. Die Endsilben -de und –ne der
Standardsprache hat das Mayener Platt nicht, so dass heute die Pluralformen kürzer sind als die zugehörigen
Singularformen: Hänn ‘Hände‘ (Singular Hand), Hünn ‘Hunde‘ (Singular Hónd), Zänn ‘Zähne‘ (Singular Zannt),
Stunn ‘Stunde‘ (‘Stunde‘ hat aber auch noch die Pluralform Stunne).
Die häufige standardsprachliche (e)n-Endung schwächen Mayener Substantive regelmäßig zur Endung –e ab, d. h.,
auch hier fällt etwas ab: ‘Bären‘ Bäre, ‘Christen‘ Chrisde, ‘Helden‘ Helde, ‘Menschen‘ Mönsche, ‘Figuren‘
Fijure, ‘Herren‘ Hääre, ‘Himbeeren‘ Émbere, ‘Mützen‘ M´ötsche, ‘Frauen‘ Fraue.
Das Pluralsuffix –er, z. B. in ‘Kinder‘ Kénner, kennt das Mayener Platt auch, aber es tritt auch in anderen
Wörtern als in der Standardsprache auf. Es heißt z. B. Bedder ‘Betten‘, Feller ‘Felder‘, Perder ‘Pferde‘,
St´ögger ‘Stücke‘, Himmer ‘Hemden‘, Dinger ‘Dinge, Sachen‘, Klötzer ‘Klötze‘, Mädscher ‘Mädchen‘, Määrscher
‘Märchen‘.
Statt der standardsprachlichen Mehrzahlendungen ‘-ln, -rn‘ heißt es –len bzw. –ren, wobei das n am Ende aber
wieder abfällt: Die ‘Amseln‘ werden zu Amselen minus -n, also Amsele, die ‘Angeln‘ zu Angelen minus n, also
Angele, ‘Fackeln‘ zu Faggele, ‘Klingeln‘ zu Klingele und ‘Bauern‘ zu Baueren minus n, also Bauere, ‘Federn‘
zu Fäädere, ‘Nachbarn‘ zu Nòòbere, ‘Eltern‘ zu Ellere.
Auch, wo die Substantive der Standardsprache auf -er enden ‘Mutter /Mütter‘, ‘Vater / Väter‘, hängt das Mayener
Platt wieder ein –e an, korrekter: ein –en, bei dem das –n wegen der Apokope getilgt wird: ‘Fenster ‘ wird zu
Fisderen minus n, also Fisdere, ‘Mütter‘ zu Móddere, ‘Väter‘ zu Vaddere, ‘Eimer‘ zu Amere, ‘Messer‘ zu Mesere,
‘Muster‘ zu Mósdere, ‘Pullover‘ zu Pullovere, ‘Sommer‘ zu Summere, ‘Winter‘ zu Wéndere usw. Nicht alle Wörter
dieses Musters haben standardsprachliche Entsprechungen, etwa Plòòdere ‘Bladern, d. h. (mit Wasser gefüllte)
Hautblasen‘, Binnere ‘Ziegen‘, Klafdere (Klafter) ‘Schwatzbasen‘. Verschiedene Substantive, die durch Apokope
auf –e enden, z. B. Hubbe ‘Huppen / Haufen‘, D´öbbe ‘Düppen /Topf‘, Jubbe ‘Juppen /Strickjacke‘ haben im
Plural dieselbe Form wie im Singular (der /dee Hubbe, dat / dee D´öbbe, der / dee Jubbe) oder hängen im Plural
an den Wortstamm –eren an, was durch n-Tilgung zu –ere wird, also Hubbere, D´öbbere, Jubbere.
Bei standardsprachlichen Pluralformen mit –el am Ende hängt das Mayener Platt ein –en, bei dem aber wieder das
n getilgt wird, an: ‘Teufel-‘ Deuwele, ‘Ekel-‘ Äägele, ‘Löffel-‘ Löwwele, ‘Kittel-‘ Kiedele, ‘Knüppel-‘
Knöbbele, ‘Kessel-‘ Kessele. Auch viele Mundartwörter bilden nach diesem Muster den Plural, z. B. Atzele
‘Elstern‘, Batschele ‘Schwatzbasen‘, Bunzele ‘Kotklümpchen vom Tier’, Erbele ‘Erdbeeren‘, Prämele /Brambeeren
‘Brombeeren‘, Krünschele ‘Stachelbeeren‘.
Die Substantivendung –es, die es im Mayener Platt im Singular gibt, bildet den Plural durch Anhängen von –e.
Es entsteht die Endung –esse, z. B. Heulesse ‘(männl.?) Heulsusen‘, Pr´öllesse ‘Kinder, die oft und lautstark
weinen‘ (zu Brülles), Kniewesse "im Wachstum zurückgebliebene[.] Mensch[en]" (RHEIN. 4, 931) (zu Knibes) und
Króllesse sind ‘Locken‘. Der Plural von Verkleinerungsformen (Diminutiven), für die die Standardsprache keine
eigene Endung hat, lautet –scher, z. B. bei dee Bäumscher ‘die Bäumchen‘, bzw. –jer, z. B. bei dee Plätzjer
‘die Plätzchen‘.
Abgesehen von wenigen Resten, wird im Mayener Platt nicht am Substantiv gekennzeichnet, welcher Fall es ist,
sondern dies geschieht durch den Artikel. (Der (Rheinische) Akkusativ wird im Kapitel zum Artikel behandelt.)
Der Genitiv oder Wes-Fall wird im Mayener Platt kaum verwendet. In wenigen feststehenden Ausdrücken, z. B. dat és et
(nét) de (Möh) wert ‘das ist (nicht) der Mühe wert‘ und e és säines Kopps ‘er ist eigensinnig; wörtl. er ist
seines Kopfes‘, säi és Kopps klaaner ‘sie ist einen Kopf kleiner; wörtl.: sie ist Kopfes kleiner‘, jangk däiner
Wääsch (veraltet) ‘lass mich in Ruhe; wörtl.: geh deiner Wege‘, ma és säines Lääwens nimmieh séscher ‘man ist
seines Lebens nicht mehr sicher‘, und in Bildungen wie M´öddersches – Mütterchens ‘Mutter und Kind‘,
Nòhläufjes - Nachläufchens ‘Nachlaufen spielen‘, Verstääschjes - Verstechchens ‘Verstecken‘, Söößjes –
Sößchens ‘Béchamelkartoffeln’ kommt er noch vor.
Die historisch gesehen ebenfalls genitivische Endung bei die Hoffmanns, Weckbeckers, Paluchs kennzeichnet einen
Plural, denn sie fasst alle Familienmitglieder zu einer Einheit zusammen: „Der Artikel im Pl. vor FN.
[Familiennamen; G. D.-S.] mit der angehängten Genit.-Endung -s (-sch) oder -en [in Mayen: -e; G. D.-S.] (je
nach der st. oder schw. Flexion) bedeutet die Gesamtheit der Mitglieder der Familie; der Artikel kann aber auch
fehlen.“ Nach den Regeln der Beugung wird –s, -sch oder –en angehängt: Bei Diederéschs (‘Diederichs‘),
Scheurens, Rathschecks wird -s angehängt. Mit –sch enden Schnäidersch (‘Schneiders‘), Weckbeggersch
(‘Weckbeckers‘) und Waldhausersch (‘Waldhausers‘), Müllersch ‘Müllers‘, Mohrsch ‘Mohrs‘, also Namen, die mit
–er oder -r aufhören. Die Endung -en, wobei das -n wieder entfällt, findet sich bei Schmidde (‘Schmidts‘),
Kirsde (‘Kirsts‘), Kullaase ‘Kohlhaas‘‘, Busche ‘Buschs‘. Diesen Familiennamen, die i. d. R. ohne Artikel
gebraucht werden, etwa Diederéschs, Schmidte, Weckbeggersch, Waldhausersch wòren dò. ‘Diederichs, Schmidts,
Waldhausers waren da.‘ entspricht die standardsprachliche Singularform (die) Familie Diederich, (die) Familie
Schmidt, (die) Familie Weckbecker, (die) Familie Waldhauser. Die standardspracliche Singularform gibt es im
Mayener Platt nicht. Der Artikel kann vor den Namen gesetzt werden - nur hat das eine andere Bedeutung als in
der Standardsprache: Wird der Artikel davorgesetzt, wird Abschätzigkeit ausgedrückt, dee (räije) Hillesheims,
dee frääje XYs, oder es folgt eine Erläuterung, etwa dee Kirsde, dee in da Jerwerstròòß wónne. Auch auf
einzelne Familienmitglieder wird ohne Artikel referiert und der Nachname wird zuerst genannt: Isberts Ruth,
Hoffmanns Klara, Diederéschs Tina, Paluchs Christopher, Schnäidersch Karin, Weckbeggersch Matthias, Schmidde
Jürgen, Kirsde Margret, Krause Maria. *Et Isberts Ruth geht nicht. Die volle Form des Artikels (dä ‘der‘, dat
‘das‘) kann aber im selben Sinn wie bei der Pluralform gebraucht werden: dat Kirsde Margret, dat ... ‘das
Kirste Magret, das ...‘, der Schmidde Jürgen, der ... ‘der Schmidten Jürgen, der ...‘. Die schwache Form des
Artikels (de ‘der‘, et ‘es‘) kann aber in Anlehnung an die Standardsprache gebraucht werden de Lothar Schmidt,
et Maria Schmidt, was aber kein echtes Platt mehr ist. Dabei wird, anders als im Platt, der Vorname zuerst
genannt. Die feminine standardsprachliche Singularform ‘die Maier‘ (*dee Maier) kommt im Mayener Platt nicht
vor. Es heißt neutral einfach de Frau Maier oder abschätzig oder wenn etwas ergänzt wird, dee (betont) Frau
Maier bzw. dat Maiersch Helga! ‘das Maiersche Helga!‘, d. h. Helga aus der Familie Maier. Der Fall, dass der
Nachname nicht flektiert wird, wie z.T. im Bairischen und im Hessischen, ist extrem selten: de Schnäider
Kl`ö`ös ‘der Schneider Klaus‘ und de Sch`ö`öwer Karel ‘der Schäfer Karl‘. Der unbetonte Artikel de gehört dazu.
Was bei Frauen nicht geht, also*dee Maier, ist für Männer eine gängige nicht wertende Bezeichnung: de
Pl`ö`öser ‘der Bläser‘, de Geisen ‘der Geisen, de Nöden ‘der Nöthen‘.
Die standardsprachliche Konstruktion Franks Haus, Hannahs Mutter, Lothars Auto, den sogenannten sächsischen
Genitiv, gibt es nicht. Statt des Genitivs wird im Mayener Platt als dialektale Ersatzform der sogenannte
Possessive Dativ verwendet. Die normalerweise gebrauchte Form mit dem unbetonten Artikel heißt im Singular: em
Frank säi Haus ‘dem Frank sein Haus‘, em Hannah säi Módda ‘dem Hannah seine Mutter‘, em Lothar säi Audo ‘dem
Lothar sein Auto‘, em Claudi säine Mann ‘dem Claudi sein (= eigtl. seinen) Mann‘. Die Verwendung des betonten
Artikels an Stelle von em, also: demm (Frank bzw. Claudi), zeigt an, dass es entweder a) mehrere Franks bzw.
Claudis gibt und es geklärt werden muss, um welchen Frank, welche Claudi es sich handelt (Betonung auf demm),
oder dass es b) Franks, nicht Ingos Mutter (Betonung auf Frank) bzw. Claudis, nicht Tinas Mann ist (Betonung
auf Tina). Ohne Eigennamen muss es demm Mädsche säi Módda heißen, egal, ob ‘die Mutter des Mädchens‘ oder ‘die
Mutter des Mädchens und nicht die des Jungen‘ gemeint ist.
Im Plural heißt es z. B. Paluchs ihre Jogi ‘Jogi Paluch; wörtl. Paluchs ihren Jogi‘, Hoffmanns ihr Klara ‘Klara
Hoffmann; wörtl. Hoffmanns ihr Klara‘. Oder: Denne Kénner / Junge /Mädscher ihr Vadder és dahaam: ‘Der Vater
der Kinder / Jungen / Mädchen ist daheim; wörtl.: denen Kindern / Jungen / Mädchen ihr Vater ist daheim.‘ und
denne Kénner ihr Tellere stinn ó’m D´ösch. ‘Die Teller der Kinder stehen auf dem Tisch; wörtl.: denen Kindern
ihre Teller stehen auf dem Tisch.‘
Diese Dativkonstruktion wird von der modernen Sprachkritik als Beispiel für jüngeren Sprachverfall verspottet,
hat aber in Wirklichkeit uralte Wurzeln: Eine Vorläuferkonstruktion findet sich schon in einem der ältesten
Texte des Deutschen. In den Merseburger Zaubersprüchen aus dem 8./9. Jahrhundert n. Chr. heißt es: „du wart
demo balderes folon sin fuoz birenkit“ ‘da wurde dem Balders [ein Gott] Fohlen [Pferd] sein Fuß verrenkt‘.
Die Reihenfolge der Satzteile beim Possessiven Dativ ist der genitivischen standardsprachlichen genau
entgegengesetzt: Der Satzinhalt Die Mutter des Mädchens kommt. lautet im Mayener Platt Demm Mädsche säi Módder
kümmt. ‘wörtl.: Dem Mädchen seine Mutter kommt.‘, also komplett andersherum. Bei diesem kurzen Beispiel gelingt
die gedankliche Umstellung leicht. Bei der Umwandlung des standardsprachlichen Satzes Die Schwester der Mutter
des Mädchens kommt. in Demm Mädsche säiner Módda ihr Schwester kümmt. wörtl.: ‘Dem Mädchen seiner Mutter ihre
Schwester kommt.‘ braucht es schon einen Moment der Überlegung. Nur zur Demonstration sei noch ein weiteres
konstruiertes Beispiel angeführt: Lòh és doch demm Jung säiner Módder ihrem Freund säine Hónd! (‘Da ist doch
der Hund des Freundes der Mutter des Jungen! Wörtl.: Da ist doch dem Jungen seiner Mutter ihrem Freund sein
Hund!‘). Beim letzten Beispiel ist die gedankliche Umstellung eine Herausforderung – in beide Richtungen. Auch
in der Konstruktion solcher Sätze mit von statt mit dem possessiven Dativ, die im Mayener Platt ebenfalls
möglich ist, ist die Reihenfolge der Teile des Satzes so wie in der Standardsprache: Der Hónd vón demm Freund
von der Módder vón demm Jung.
Weitere resthafte Dativkennzeichnung am Substantiv leisten die Tonakzente, wo sich z. B. dat Hau²s (‘das Haus‘),
z. B. Dat és dat Haus., d. h. Nominativ mit Tonakzent 2, und ém Hau1s (‘im Hause‘) E és ém Haus., d. h. Dativ
mit Tonakzent 1, gegenüberstehen - entsprechend auch der Ha²ls und ém Ha1ls usw. Aber mit dem bestimmten Artikel
oder dem Possessivpronomen wechselt der Tonakzent wieder: én demm Hau²s ‘in dem (=jenem) Haus‘, én mäinem
Ha²ls ‘in meinem Hals‘. Im Plural ist der Dativ am Substantiv und am Artikel zu erkennen: én denne Schachdele
‘in den Schachteln; wörtl.: in denen Schachteln‘, je nach Pluralbildung des Substantivs aber auch nur am
Artikel: Nòh all denne Jòhr ‘nach all den Jahren; wörtl.: nach all denen Jahr‘, én all denne Häuser ‘in all
den Häusern; wörtl. in all denen Häuser‘. Weitere Beispiele sind: én denne Schoh ‘in den Schuhen; wörtl.: in
denen Schuhen‘, én denne Schränk ‘in den Schränken; wörtl.: in denen Schränken‘.
Auch die Art der Verkleinerung unterscheidet sich zwischen dem Mayener Platt und der Standardsprache. Die
Standardsprache hat zwei Verkleinerungsendungen, -chen und -lein, das Mayener Platt nur eine: –chen. Die Endung
–lein existiert im Mayener Platt nicht. Dafür kommt –chen aber in drei Varianten vor: -sche, -je, -elsche. Im
Mayener Platt ist es nicht möglich, nach Belieben eine Variante auszuwählen, sondern es gibt Regeln. In der
Standardsprache sind zwar oft–lein oder–chen wahlweise anzuhängen, es geht längst aber nicht bei jedem
Substantiv. Welche der drei Varianten der Endung -chen jeweils in Mayen in Frage kommt, hängt vom betreffenden
Substantiv ab, genauer: von dem Laut, mit dem es endet. Durch diesen ist die Verkleinerungsvariante festgelegt.
Im Unterschied zur Standardsprache kennt das Mayener Platt außerdem Pluralformen bei Diminutiven. Diese enden
auf -r und je nach Endung heißen sie -scher, -jer oder-elscher, beispielsweise aa/e Prüütsche (‘ein Brötchen‘)
- träi Prüütscher (‘drei Brötchen‘), aa/e D´ötzje (‘frecher kleiner Junge‘) – träi D´ötzjer (‘freche kleine
Jungen‘), aa/e Bööjelsche (‘Büchelchen‘) – zwei Bööjelscher (‘zwei Büchelchen‘). Substantive, die auf
d, i, k, l, m, n, p, r, t, u enden, bilden die Verkleinerung ausnahmslos mit –sche, im Plural –scher:
Diddische – Diddischer ‘Baby /Babys‘, G´örksche – G´örkscher ‘Gürkchen‘, W´ölksche – W´ölkscher ‘Wölkchen‘,
Stöhlsche – Stöhlscher ‘Stühlchen‘, Bäumsche - Bäumscher ‘Bäumchen‘, Männsche – Männscher ‘Männchen‘, S´öppsche
– S´öppscher ‘Süppchen‘, Düürsche – Düürscher ‘Türchen‘, Bettsche – Bettscher ‘Bettchen‘, Woort – Wöörtsche
‘Wörtchen‘. Die Endung –elsche ‘–elchen‘ kann nicht stattdessen angehängt werden.
Substantive, die mit f, s, tz, scht, z enden, haben im Singular das Suffix –je, im Plural –jer: Räifje – Räifjer
‘kleine Reibe /Reiben‘, Häusje – Häusjer ‘Häuschen‘, Düüsje – Düüsjer ‘Döschen‘, D´ötzje - D´ötzjer ‘frecher
kleiner Junge /freche kleine Jungen‘, Wüaschtje – Wüaschtjer ‘Würstchen‘. Die Endung–elsche ‘–elchen‘ kann nicht
stattdessen angehängt werden. Nach stimmlosem -ch [x] am Wortende, z. B. Auch ‘Auge‘, Daach ‘Dach‘, Bauch
‘Bauch‘, Baach ‘Bach‘ oder Booch ‘Buch‘, heißt es weder –sche noch –je, sondern –elsche. Es kann nicht, wie
das bei diesen Wörtern in der Standardsprache geschieht, die Endung –lein verwendet werden, da es diese nicht
gibt. Die Verkleinerungsformen hießen*Äugsche (von ‘Auge‘), *Däschsche (von ‘Dach‘), *Bäuschsche (von ‘Bauch‘),
*Bäschsche (von ‘Bach‘), *Bööschsche (von ‘Buch‘), was kaum sprechbar ist. Bei diesen Wörtern fügt auch die
Standardsprache ein -el ein, also –elchen: Auge - Äugelchen. Das stimmlose -ch [x] am Wortende wandelt sich im
Platt in -j, so dass es Äujelsche ‘Äugelchen‘, Dääjelsche ’Dächelchen‘, Bäujelsche ‘Bäuchelchen‘, Bääjelsche
‘Bächelchen‘, Bööjelsche ‘Büchelchen‘ heißt. Die Pluralbildung bei diesen Substantiven erfolgt mit –scher,
Äujelscher, Dääjelscher usw. Die Substantive, die auf -e enden, die dem standardsprachlichen –en entsprechen,
haben –elsche als Verkleinerungsendung:
Kraare -Kräjelsche ‘Kragen – Krägelchen‘, Waare - Wäjelsche ‘Wagen – Wägelchen‘ (neben der älteren Form
W`ö`önsche ‘Wägenchen‘), Maare – Mäjelsche ‘Magen – kleiner Magen‘, Boore - Bööjelsche ‘Bogen – kleiner Bogen‘.
Koore – Kööjelsche ‘Kuchen – kleiner Kuchen‘. Bei ‘Magen‘ und ‘Bogen‘ kennt der Duden keine Form der
Verkleinerung. Im Plural wird –scher verwendet. Bei Substantiven wie Hubbe ‘Huppen / Haufen‘, D´öbbe ‘Düppen /
Topf‘, Labbe ‘Lappen‘, Trepp ‘Treppe‘, Krépp ‘Krippe‘, Répp ‘Rippe‘ wird wie in der Standardsprache an den
Wortstamm -sche ‘-chen‘ gehängt: Hüppsche, D´öppsche, Läppsche, Treppsche, Kréppsche, Réppsche. Stattdessen
–elchen anzuhängen ist nicht möglich.
Substantive, die im Mayener Platt auf ck, ng, nk enden, können das Diminutiv wahlweise mit -sche oder mit
–elsche bilden: Deck - Decksche / Deggelsche ‘Decke - Deckchen‘, Pr´öck - Pr´öcksche / Pr´öggelsche ‘Brücke
- kleine Brücke‘, Brogge – Pröcksche / Pröggelsche ‘Brocken - Bröckchen‘, Eck -Ecksche /Eggelsche ‘Ecke -
Eckchen‘, St´öck – St´öcksche / St´öggelsche ‘Stück - Stückchen‘, Stóck - Stöcksche / Stöggelsche ‘Stock -
Stöckchen‘ (gegenüber Stock wird aber Stecken bevorzugt), Zang - Zängsche / Zängelsche ‘Zange - Zängelchen /
Zänglein‘, Schlang Schlängelsche – ‘Schlange – Schlängelchen‘, Stang - Stängelsche / Stängsche ‘Stange –
Stängelchen‘, Jung – Jungsche (DUDEN: „familiär“) / Jüngelsche (abwertend, wenn es nicht ein Kleinkind ist),
Spang - Spängsche / Spängelsche ‘Spange – Spängelchen‘, Schrank - Schränksche /Schränggelsche ‘Schrank -
Schränkchen‘, Bank – Bänksche / Bänggelsche ‘Bank – Bänkchen‘. (Bei Klüggelsche ‘Glückelchen (zu Glucke), d. h.
Küken‘ ist aber ausschließlich diese Form möglich.) Der Plural lautet entsprechend z. B. Deckscher oder
Deggelscher ‘Deckchen‘.
Nach -sch am Substantivende im Mayener Platt, was relativ selten vorkommt, gibt es beim Diminutivsuffix die
Auswahl zwischen –je und -elsche: So heißt es M´ötschje oder M´ötschelsche ‘Mützchen‘, D´öschje oder
D´öschelsche ‘Tischchen‘, F´öschje oder F´öschelsche ‘Fischchen‘, Fröschje oder Fröschelsche ‘Fröschchen‘,
K´öschje oder K´öschelsche ‘kleine Küche‘. Die Verkleinerungsform zu ‘Arsch‘ heißt aber nur `Ö`öjelsche
‘Ärschelchen‘. Entsprechend gibt es als Pluralform M´ötschjer und M´ötschelscher ‘Mützchen‘ usw. Die Form mit
–elsche ist die i. d. R. gebrauchte. Die Ansicht, bei Diminutivformen wie ‘Stückelchen‘ St´öggelsche oder
‘Stöckelchen‘ Stöggelsche handele es sich um doppelte Verkleinerungen, wird nicht geteilt. Es wird vielmehr so
gesehen, dass ‘–el‘ ein Teil der Endung ‘–elchen‘ ist und dass also Stückel nicht schon eine Verkleinerung von
‘Stück‘ ist, d. h., nicht als ‘Stückchen‘ gesehen wird, und es folglich nicht Stückel+chen heißt, sondern
Stück+elchen, und ‘Stück‘ nur einmal verkleinert ist. Dies stimmt völlig mit der hochdeutschen Standardsprache
überein, wo z. B. der besseren Sprechbarkeit wegen aus Auge Äugelchen, aus Wagen Wägelchen und aus Bauch
Bäuchelchen werden. Ebenfalls ist es nicht möglich, wo –sche bzw. –je angehängt wird, dieses durch –elsche
auszutauschen. Auch in anderen Fällen, um es besser sprechen zu können, gibt es einen Einschub von -el, etwa
bei Wergeldaach ‘Werktag‘, säidelsches ‘seitwärts; wörtl.: seitelchens‘ oder Fastelòòvend ‘Fastelabend‘. GEORG
WENKER schreibt hierzu schon 1877: „Am schönsten aber scheiden sich die vier bergischen Dialecte durch die Art,
wie sie Verkleinerungswörter, wie S t ö c k c h e n, H ä u s c h e n, B ä u m c h e n, B ä n k c h e n bilden.
Wenn man die Verkleinerungswörter untersuchen will, so muß man auf zweierlei Acht geben: 1) muß man die Wörter,
die auf k, ch, g, ng endigen, genau von allen andern trennen, diese nehmen eine andere Endung an als die andern;
das kommt aber bloß daher, weil man nicht bequem B ü c h c h e n, T ü c h c h e n, A e u g c h e n sagen kann
und man deshalb einen Buchstaben zur Erleichterung hat einschieben müssen“.
Eine doppelte Verkleinerung ist natürlich möglich durch Hinzufügen von ‘klein‘: e klaa St´öggelsche, Bäujelsche,
Fisdersche, Deersche, Hünnsche ‘ein kleines Stückchen, Bäuchelchen, Fensterchen, Tierchen, Hündchen‘ usw.
Darüberhinaus ist–elsche im Platt eine Art „universelle“ Verkleinerungsendung, die es erlaubt, bei Substantiven
Diminutive zu bilden, wo es in der Standardsprache keine gibt und wo ‘klein‘ hinzugefügt werden muss, z. B.
Berg - Berjelsche / Bergelchen ‘(kleiner) Berg‘, Buggel - Büggelsche / Bückelchen ‘(kleiner) Buckel, Rücken‘,
Maare - Mäjelsche ‘(kleiner) Magen‘, Zuch –Züschelsche ‘Zug – kleiner Zug‘, Stréck -Stréggelsche ‘(kleiner)
Strick‘, Streck - Streggelsche ‘(kleine) Strecke‘, Jangk - Jängelsche ‘(kleiner) Gang‘, auch: ‘eine kurze
Strecke gehen‘. Die hochdeutsche Standardsprache kennt weder *Bergchen noch *Berglein, weder *Buckelchen noch
*Buckellein usw. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Substantiv ohne Beachtung der Bedeutung verkleinert werden
kann: Burg, Geburt, Fahrt, Tag z. B. bleiben auch im Platt unverkleinert.
Die Verkleinerungsformen werden im Mayener Platt (großenteils) wie in der Standardsprache gebraucht und
beschreiben ganz neutral die Größe von etwas: Schauwel - Schauwelchen ‘kleine Schaufel‘, Düür – Düürsche
‘kleine Tür‘, Bócks – B´öcksje ‘kleine Hose‘. Mitunter schwingt auch ein emotionaler Unterton mit Ploom –
Plöömsche ‘kleine Blume vs. Blümchen‘, Haus – Häusje ‘kleines Haus vs. Häuschen‘, Deer – Deersche ‘kleines Tier
vs. Tierchen‘, Hónd - H´ünnsche ‘kleiner Hund vs. Hündchen‘.
Die Unterschiede zwischen Pruut – Prüütsche ‘Brot – Brötchen‘, Wuascht – Wüaschtje ‘Wurst – Würstchen‘,
Steefmódder – Steefm´öddersche ‘Stiefmutter – Stiefmütterchen‘ sind im Platt dieselben wie in der
Standardsprache.
Auch Fälle, wo es nur eine diminuierte Form gibt, die sich verselbständigt hat, wie bei Plätzje – Plätzjer
‘Plätzchen‘, zu denen im Platt noch der Platz, ein rundes, flaches, leicht süßes Hefegebäck gehört ,
Eischhörnsche – Eischhörnscher ‘Eichhörnchen‘ sowie Fung-gemariesche - Fung-gemariescher ‘Funkenmariechen‘,
Himmelsdeersche – Himmelsdeerscher ‘Marienkäfer, wörtl.: Himmelstierchen‘, Klüggelsche - Klüggelscher ‘Küken,
wörtl.: Glückelchen; zu: Glucke‘, Hämmsche - Hämmscher 'Eisbein, gekochte Schweinshaxe; zu: Hame '; (RHEIN. 3,
173; Vorderhaxe) kommen relativ häufig vor. Etliche von diesen werden meist oder doch überwiegend im Plural
gebraucht: Jänseplöömscher ‘Gänseblümchen‘, Mutzemändelsche – Mutzemändelscher ‘Mutzenmandel; Fastnachtsgebäck‘
, Kr´öbbelsche – Kr´öbbelscher ‘Kröbbelchen = Reibekuchen‘, Bibbeföößje – Bibbeföößjer ‘sehr kleine Schritte
(wie ein Huhn)‘, Pr`ö`ötsche – Pr`ö`ötscher ‘die Kruste an Bratkartoffeln, wörtl. Brätchen‘.
Verniedlichend kann der Gebrauch des Diminutivs im Platt auch sein: Frauen bekamen früher kein Kind, sondern e
Kinnsche ‘ein Kindchen‘, e Mädsche oder e Jüngelsche. Im moderneren Sprachgebrauch wurde e Babysche (mit a
gesprochen) daraus. Im Gespräch mit Kleinkindern wurde der Säugling als Diddi ‘Titti‘ bezeichnet, meist noch
einmal verkleinert als e Diddische. Da in der Kindersprache Diminutive oft verwendet wurden und werden, heißt
es Schlüppsche ‘Schnuller‘ (dagegen früher: Schlupp ‘Sauger der Babyflasche‘), Fläschje, Schöhsche etc. Es
scheint / schien auch et Sönnchen und wenn es gedonnert hatte, hieß es: Et Goddesje schännt. ‘Der liebe Gott
schimpft, wörtl. es Gotteschen schändet‘.
Die (ehemalige) Verkleinerung von ‘Frau’ in e leef, düschdésch Fräusche ‘eine nette, tüchtige Frau; wörtl. ein
lieb(es), tüchtig(es) Fräuchen‘ oder von ‘Mann‘ in e fäi Männsche ‘ein feiner Mann; wörtl. ein fein(es)
Männchen‘ ist ausschließlich positiv und wohlwollend zu verstehen, mehr noch als die unverkleinerte Form. Die
Bezeichnung aal Fräusche oder aal Männsche ist mitleidig. Wird dagegen eine ‘Nonne‘ nur Nunn statt Nünnsche
‘Nönnchen‘ genannt, hält man sie für ein Biest. Kommt jemand in Mayen én’t Klüsdersche ‘wörtl.: in es
Klösterchen‘, dann geht er nicht etwa ein kleines Kloster, sondern in das Altersheim mit dem Namen St. Johannes,
der von Mayenern wohl noch nie gebraucht wurde. Beschönigend ist der Gebrauch von Büggelsche statt Buggel, für
die Verkrümmung der Wirbelsäule zwischen den Schulterblättern. Besonders ein Kind wurde gemahnt, ein anders
bloß nicht fallen zu lassen: Sóss krischt et e Büggelsche! ‘Sonst kriegt es ein Bückelchen!‘ Während e Leedsche
einfach nur ‘ein Liedchen‘ ist, ist e Jüngelsche, sofern es sich nicht um ein Kleinkind handelt, ‘ein unreifer
Halbwüchsiger‘. Ähnlich herabsetzend ist Männesje ‘Männlein‘ – es sei denn, es ist ein Kleinkind gemeint.
Während dee Wäiwer ‘die Weiber‘ nur leicht abschätzig ist, ist e treggésch Wäif ‘eine böse Frau; wörtl. ein
dreckiges Weib‘ und e Wäifje abschätzig im moralischen Sinn, im Gegensatz zum o. g. Fräusche. Ziemlich
abschätzig ist auch, e Jeschäutsche ‘ein Gescheitchen‘ genannt zu werden, denn es bedeutet ‘Klugscheißer‘. Als
S´öffje ‘Süffchen‘ zu gelten ist weniger schlimm als en S´öffer ‘Säufer‘ zu sein. Wird ein 'dicker, rundlich
geformter fester Po, bes. bei Kindern' Schössje genannt, ist dies eine scherzhafte Anspielung auf ein ähnlich
geformtes Brötchen und dass er recht kräftig ist.
Verkleinert werden auch Vornamen, und zwar die von Mädchen und von Jungen: et Ruthsche, et Mariesche, et
Cläudsche, et Tinsche und et Kurtsche, et Fränzje, et Paulsche, et Rölfje. Manchmal bleibt diese Form
lebenslang erhalten. Gern sind auch Kosenamen verkleinert. Einige ältere (ausgestorbene?) sind: mäi Züggersche,
mäi Mutzemändelsche, mäi Bömbesje, mäi Herzplättsche, mäi Butzelsche, mäi Bunnesje, mäi Bunzelsche, mäi
St´ömpsche / St´ömbesje ‘mein Zückerchen, mein Mutzenmändelchen, mein Bömbchen, mein Herzblättchen, mein
Butzelchen, mein Bunnes-chen (Kälbchen), mein Bunzelchen (Knödelchen), mein Stümpchen‘. Dagegen bleiben
Schimpfwörter, was ja „natürlich“ ist, i. d. R. unverkleinert: Affezabbe / Affenzapfen 'Narr; jemand der etwas
Kindisches oder Verrücktes tut, Blödmann'., Baiass 'Komödiant, Clown, Spaßmacher; auch als Schimpfwort
gebraucht'; (zu: Bajazzo), Lämmes 'einfältiger, sehr geduldiger Mann‘ (zu: Lamm), Spròòrer /Spracher 'Jemand,
der wichtigtuerisch gern viel und weitausholend erzählt, redet', Päutert 'feister, beleibter Mann, Dickwanst',
Pl`ö`ödekopp / Plättenkopf verächtlich 'Mann, der einen kahlen Schädel hat' u. v. a. m.
M. W. sind dem Mayener auch e Beer, en Wäin, en Schnaps, en Zigarett ón en Tass Kawwie lieber als das heute
moderne Weinchen, Bierchen, Schnäpschen und das Tässchen Kaffee, das getrunken, und das Zigarettchen, das
geraucht wird.
Aus dem Diminutivsuffix –chen ist die Endung -chens [ʃəs] bzw. -jes [jəs] abgeleitet und häufig bei der
Bezeichnung von Kinderspielen zu finden: Käulsches [ˈkœʏ¹lʃəs] (‘Käulchens‘ ein Klickerspiel, d. h. Murmelspiel)
, M´öddersches [ˈmødɑʃəs] (‘Mütterchens‘ = Mutter und Kind‘), Nòhläufjes [ˈnɔː¹lœʏ²fjəs] (‘Nachläufchens =
Fangen‘), Verstääschjes [faˈʃdɛː²ʃjəs] (‘Verstechchens = Verstecken‘), ‘Schule‘ Schüllsches [ˈʃʏ²lʃəs]
(‘Schülchens = Schule‘) u. a. m., aber auch bei S`ö`ößjes [zœː¹sjəs] (‘Sößchens = Béchamelkatoffeln‘),
Markklüüsjessópp [ˈmɑ²ʁəkklʏː¹sjəszop] (‘Markklößchen(s)suppe‘) und auch z. B. bei Mädscheslatsch
[ˈmɛː¹tʃəslatʃ] (veraltet: ‘Mädchenslatsche = Junge, der am liebsten mit Mädchen spielt‘) sowieVerzéllschesbooch
[faˈtse²lˑʃəsboː¹x] (veraltet: ‘Verzählchensbuch = Unterhaltungslektüre, Roman‘).
- SCHÄFER 1998, 113 (im Original nicht kursiv). ↩
- RITTEL 1998, 56 (im Original nicht kursiv). ↩
- Auf alle Formen einzugehen und sie gar systematisch zu untersuchen, ist in diesem Rahmen nicht zu leisten. ↩
- Die hier und im Folgenden gebrauchte Bezeichnung ‘Endung‘ ist nicht in jedem Fall mit dem linguistischen Terminus ‘Suffix‘ gleichzusetzen, sondern meint jeweils den Auslaut des Wortes. ↩
- Vgl. POST 1990, 107f. und auch Diminutivbildung /Bildung der Verkleinerungsform. ↩
- RHEIN. 1, 849. ↩
- Zum Abfall vom Endungs-e und Endungs-n vergleiche auch Kapitel 4. ↩
- Ähnlich sind Enn ‘Ende‘, Kunn ‘Kunde‘, Schann ‘Schande‘, Sünn ‘Sünde‘ gebildet, doch handelt es sich hier nicht um Pluralformen. ↩
- Weitere Beispiele für Substantive, die standardsprachlich auf -en enden sind Zabbe- ‘Zapfen‘, Läde- ‘Läden‘, J`ö`örde ‘Gärten‘, Käsde ‘Kästen, die kein –eren anhängen. ↩
- Vgl. auch „Zu den Verkleinerungen“ in diesem Kapitel. ↩
- Zum Artikel vgl. Kapitel 16. ↩
- Vgl. RHEIN. 1, 1322. ↩
- RHEIN. 1, 1321. ↩
- Wieso im Mayener Platt die Pluralform der Nachnamen ‘Bell‘ und ‘Koll‘ auf –e endet, nämlich Belle und Kólle, also schwach flektiert sind, ‘Keul‘ und ‘Münzel‘ aber auf –s, Keuls, Münzels, Rittels, ist m. W. noch ungeklärt. ↩
- Zum Personalpronomen et vgl. Kapitel 11. ↩
- Zum Gebrauch des sächlichen Personalpronomens und Artikels es bei weiblichen Personen vgl. Kapitel 11, besonders „Näheres zur Sicht von et und dat jenseits des Moselfränkischen“. ↩
- Die Verwendung des unbestimmten Artikels bei *em Mädsche ist in diesem Fall semantisch unsinnig, außer in ganz allgemeiner Form: Die / Eine Mutter eines Mädchens sollte nicht zu streng... sein, denn ein „unbestimmtes“ Mädchen ist nicht möglich. ↩
- Im Niederländischen, wo Diminutive äußerst beliebt sind, sind die Dininutivendungen denen des Mayener Platt sehr ähnlich: -tje, -etje, -pje, -kje en –je. Vgl. https://onzetaal.nl/taaladvies/verkleinvormen-algemene-regels. Auch hier sind es Varianten von –chen, nicht von -lein. ↩
- Ausnahmen von dieser Regel, ch in j umzuwandeln, scheinen nur drei zu sein: Zuch –Züschelsche ‘Zug – kleiner Zug‘, Loch – Löschelsche ‘Loch – Löchelchen‘ und Spróch – Spr´öschelsche ‘Spruch – Sprüchelchen‘. Im Gegensatz zu den anderen haben sie Kurzvokale und können außerdem (Ausnahme!) auch –je anhängen. ↩
- RHEIN. 7, 1774. ↩
- WENKER ²1877, 12f. ↩
- Dat schmeckt bee Platz! Ist eine veraltete Redewendung, wenn etwas besonders gut schmeckt. ↩
- Die Großmutter der Autorin war noch mit 84 Jahren Oma Gretsche, ihre Schwester et Mariesche, und in einer Gruselgeschichte, die der Autorin auf Platt erzählt wurde, kamen et Piddersche und et Gritsche vor. Paul Eultgen, früherer Kottenheimer Heimatdichter und Sänger, blieb bis zum Lebensende et Kóddemer Paulsche (wörtl. es Kottenheimer Paulchen). Vgl. auch Kapitel 11 die Ausführungen zum Personalpronomen 3. Pers. Sing. Neutrum. ↩
- Vgl. POST 1990, 107f. ↩
10. Adjektive
schròh, schr`öher, et schr`öhst; der aal Mann, der frääsch Panz, e aalet, e neuet, e kruuset Von den Adjektiven / Wiewörtern / Eigenschaftswörtern
Adjektive, Wiewörter, beschreiben Eigenschaften von Lebewesen, Dingen und Begriffen, z. B. der kruuß Mann ‘der
große Mann‘, dat schròh Pédsche ‘das unwegsame (wörtl.: schrahe) Pfädchen‘, dee schwer Ófgab ‘die schwierige
Aufgabe‘.
Das attributiv gebrauchte Adjektiv, also das Adjektiv, das beim Hauptwort steht, wird gebeugt. Es richtet sich in
seiner Form nach dem grammatischen Geschlecht und nach dem Kasus, dem Fall. Die Unterschiede zur Standardsprache
betreffen alle Arten der Beugung (Flexionsarten), also die Flexion nach bestimmtem Artikel, die Flexion ohne
Artikel und die Flexion nach unbestimmtem Artikel. Die Flexion nach kein entspricht derjenigen nach unbestimmtem
Artikel.
Das Schema (Paradigma) für die Flexion nach bestimmtem Artikel für die alten Formen lautet:
| KASUS | Mask. | Fem. | Neutr. |
|---|---|---|---|
| Sg. N | der goot Mann | dee goot Frau | dat goot Kénd |
| Sg. D | demm goode Mann | der goot Frau | demm goode Kénd |
| Sg. A | der goot Mann | dee goot Frau | dat goot Kénd |
Im Plural gibt es jeweils nur eine Form:
| KASUS | Mask. | Fem. | Neutr. |
|---|---|---|---|
| Pl. N | dee goode Männer | dee goode Fraue | dee goode Kénner |
| Pl. D | denne goode Männer | denne goode Fraue | denne goode Kénner |
| Pl. A | dee goode Männer | dee goode Fraue | dee goode Kénner |
Sg. = Singular /Einzahl; Pl. = Plural /Mehrzahl; N = Nominativ /Werfall; D = Dativ /Wemfall; A = Akkusativ /Wenfall; Mask. = Maskulinum /männlich; Fem. = Femininum /weiblich; Neutr. = Neutrum /sächlich.
Die endungslosen Formen im Mayener Platt im Maskulinum und Neutrum Nominativ und Akkusativ sind die älteren: der goot aal Mann, dat kaal Wasser, was auch die WENKER-Erhebung von 1887 zeigt: Obwohl die schriftliche Vorlage von 1887 ein Flexions-e bzw. –en vorgab (Satz 4 „Der gute alte Mann ist mit dem Pferd(e) durch’s Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen.“, Satz 14 „Mein liebes Kind, bleib hier unten stehen, die bösen Gänse beißen dich todt.“ , Satz 39 „Geh nur, der braune Hund tut dir nichts.“), sind die Formen in der Mayener „Übersetzung“ endungslos: „ der goot aal Mann“ und „dat kalt Wasser“, „büs Jäns“ und „der braun Hónd“. Die neueren Formen mit –e am Ende sind als Anpassung an die Standardsprache zu werten. Sie lauten für den Akkusativ (Wen-Fall): denn goode Mann, dat kal(d)e Wasser, denn braune Hónd. Bei den Pluralformen dee goode Männer, dee goode Fraue, dee goode Kénner „fehlt“ wegen der Apokope jeweils, verglichen mit der Standardsprache, das –n. Dasselbe gilt für den Dativ. Dieser ist aber durch den Artikel gekennzeichnet: Es heißt statt standardsprachlichem ‘den‘ denen. Auch die Akkusativform ist beim Maskulinum, Femininum und dem Neutrum ohne –n.
Das Schema (Papadigma) für die Flexion ohne Artikel lautet wie folgt:
Das Eigenschaftswort wird im Mayener Platt ohne Artikel genauso wie in der Standardsprache gebraucht, z. B. im Nominativ; Goode Wäin és deuer. ‘Guter Wein ist teuer.‘ Im Dativ heißt es Mét goodem Wäin schmeckt et noch besser. ‘Mit gutem Wein schmeckt es noch besser.‘, im Akkusativ: Bäim Schwindenhammer krisde goode Wäin ón goode Schóggelad. ‘Bei Schwindenhammer (Laden für Spirituosen, Tabakwaren u. Ä.) bekommt man guten Wein und gute Schokolade; wörtl.: beim Schwindenhammer kriegst du guten Wein und gute Schokolade.‘ Die Formen sind endungslos , der letzte Laut fehlt also: Im Nominativ Singular ist beim Maskulinum also goode statt ‘guter‘ (goode Wäin), am Ende kein –r, und beim Neutrum kein –es: goot statt ‘gutes‘, im Akkusativ Singular ist beim Maskulinum kein –n, goode statt ‘guten‘ (goode Wäin), und beim Neutrum kein –es, also goot statt ‘gutes‘. Beim Femininum gibt es keine Abweichungen. Im Plural (Mehrzahl) heißt es im Dativ: Mét goode Wäin /Schóggelade /Beere kennt en sésch aus. ‘Mit guten Weinen /Schokoladen / Bieren kennt er sich aus.‘ Verglichen mit der Standardsprache „fehlt“ das –n.
Weitere Beispiele für den Akkusativ: Dee hann goot Beer. (‘Sie wörtl. die haben gutes Bier‘.), E trinkt goot Beer. (‘Er trinkt gutes Bier.‘) Et isst nur goode Schóggelad. (‘Es / Sie isst nur gute Schokolade‘.) E käuft ümmer goode Wäi¹n. (‘Er kauft immer gute Weine.‘) Beispiele für den Nominativ finden sich im Wenker-Bogen für Mayen von 1876 („rheinische Sätze“). Sie sind in moderner Transkription wiedergegeben. Satz 9: „Gestern war schlecht Wetter.“ Jesder wòr schlääscht Wääder. Satz 20 „Es sind schlechte Zeiten.“ Et säin schlääschde Zäide. Bei den (zugegebenermaßen veralteten) Anreden ist die korrekte Form aber: Gooder Mann! ‘Guter Mann!‘ oder Leef /Goot Frau ‘Liebe /Gute Frau!‘ und ‘Guten Tag!‘ heißt Gó‘n Dacht!
Für die Flexion nach unbestimmtem Artikel lautet das Schema wie folgt:
| KASUS | Mask. | Fem. | Neutr. |
|---|---|---|---|
| Sg. N | en goode Mann | en goot Frau | e goot Kénd |
| Sg. D | em goode Mann | a (=einer) goot Frau | em goode Kénd |
| Sg. A | en goode Mann | en goot Frau | e goot Kénd |
Die Flexion mit unbestimmtem Artikel, also die nach ‘ein / eine‘, weicht auch von derjenigen der Standardsprache
ab.
Im Singular heißt es beispielsweise für den Nominativ: E és en arme Kerl. ‘Er ist ein armer Kerl.‘ Se és en
goot Frau. ‘Sie ist eine gute Frau.‘, Dat és e schròh Klaad. ‘Das ist ein hässliches Kleid.‘, für den Dativ:
Et sétzt én em bequeme Sessel. ‘Es sitzt in einem bequemen Sessel.‘ E wónnt en a klaan Wónnung. ‘Er wohnt in
einer kleinen Wohnung.‘ Der wónnt én em kruuse Haus. ‘Er wohnt in einem großen Haus.‘, Dat jénnéja arm Frau.
‘Das gebe ich (irgendeiner) armen Frau.‘ Dat jénnéjem arme Kénd. ‘Das gebe ich (irgendeinem) armen Kind.‘, für
den Akkusativ: De has en schöne Hoot. ‘Du hast einen schönen Hut.‘ Ésch brauren en neu Bócks. ‘Ich brauche eine
neue Hose.‘ Se hat e leef Kénd. ‘Sie hat ein liebes Kind.‘
Beispiele für endungslose Formen aus dem Wenker-Bogen von 1876 (in moderner Transkription): Satz 8 „Man muß
ihn bedauern, er ist ein gutmüthig Schaf.“ Ma mooß in bedauere, ä és e gootmöhdésch Schòòf (angenähert an die
Schreibung im Originalbogen). Satz 19 „Er macht heut ein wüthig Gesicht.“ E mischt heut e wöhdésch Jesischt.
Satz 24: „Ich möchte ein halb Pfund Wurst haben.“ (Hier gibt es nur den Wenkersatz, aber keine Übertragung ins
Mayener Platt.)
Wie in der Standardsprache gibt es auch im Platt im Plural keine Formen für den unbestimmten Artikel, er fehlt
einfach: Kénner k´önnen dat nét w´öse. ‘Kinder können das nicht wissen.‘ Goode Kénner maaren dat nét. ‘Gute
Kinder machen das nicht.‘
Wird ein Adjektiv prädikativ oder adverbial gebraucht, ist es auch im Mayener Platt nicht gebeugt: Der Mann és
kruß. (‘Der Mann ist groß.‘) Dat Pédsche és schròh. (‘Das Pfädchen ist unwegsam; wörtl.: schrah‘.) Und: Dee
Frau singt schròh. (‘Die Frau singt scheußlich, schlecht.‘) Der Mann jaht huddésch. (‘Der Mann geht hurtig.‘)
Dat Kénd springt huh. (‘Das Kind springt hoch.‘) Et és schwer kalt. (‘Es ist schwer (=sehr) kalt.‘) E wòr schwer
fruh. (‘Er hat sich sehr gefreut, wörtl.: Er war schwer froh.‘)
Wird mit einem Adjektiv etwas klassifiziert, entspricht die Flexion beim Maskulinum und Femininum der des
attributiven Adjektivs:
Bei der Flexion nach unbestimmtem Artikel heißt es: Der Mann és en kruuse /klaane/ aale. ‘Der Mann ist ein
großer/ kleiner/ alter‘. Dee Frau és en kruuß /klaan/ aal. ‘Die Frau ist eine große /kleine /alte‘. Dat Kénd
és e kruuset/klaanet. ‘Das Kind ist ein großes /kleines‘. Dat Handooch és e neuet /klaanet. ‘Das Handtuch ist
ein neues /kleines‘. Bei der Flexion nach bestimmtem Artikel heißt es: Der Mann és der kruuß /klaan. ‘Der Mann
ist der große /kleine‘. Dee Frau és dee kruuß /klaan. ‘Die Frau ist die große /kleine‘. Dat Kénd és dat kruuß /
klaan. ‘Das Kind ist das große /kleine‘. In diesen Fällen kann aber auch die jüngere flektierte Form der kruuse
etc. gebraucht werden.
Attributiv gebrauchte Farbadjektive, die standardsprachlich unflektiert sind, werden im Platt meist flektiert:
rosane Schoh, lilane Fingern`ö`öl ‘Fingernägel‘.
Bei der Komparation, der Steigerung, werden Positiv und Komparativ wie in der Standardsprache gebildet, etwa
kruuß /klaan, krüüser /klaaner. Zum Superlativ heißt es im RHEINISCHEN WÖRTERBUCH (2, 177): „statt am besten
usf. setzt die MA. Rip, Nfrk et bes(t).“ Die in Mayen normalerweise gebrauchte Steigerung ist die mit et: et
best, et krüüßt, et klaanst. De Tobias és klaan, de Benji és klaaner, de Simon és et klaanst! ‘Tobias ist klein,
Benji ist kleiner, Simon ist es kleinst.‘ Dee Bócks és schròh, lòh hénne dee és noch schr`öher ón häi dee és et
schr`öhst. ‘Die Hose ist hässlich, jene (wörtl. dort hinten die) ist noch hässlicher und diese (wörtl. hier die)
ist es hässlichst.‘
Bei substantivierten Adjektiven ist es folgendermaßen: der Aal, der Klaan, der Kruß; dee Aal, dee Klaan, dee
Kruuß; dat Klaan, dat Kruuß; der Ääler, der Klaaner, der Krüüser; dee Ääler, dee Klaaner, dee Krüüser; dat
Klaaner, Krüüser; der Ältst (Ältsde), der Klaanst (Klaansde), der Krüüßt (Krüßde); dee Ältst, dee Klaanst. dee
Krüüßt; dat Ältst, dat Klaanst (Klaansde), dat Krüüßt (Krüüßde). Beim Vergleich heißt es bee (‘wie‘): De Simon
és klaaner bee de Benji. ‘Simon ist kleiner wie Benji.‘ Häi dee Tösch és neuer bee lòh dee. ‘Diese Tasche ist
neuer wie jene.‘
- Büs Jäns allerdings findet sich in keinem andern Wenkerbogen aus den umgebenden Schulorten. Der Form nach Entsprechendes findet sich aber in Satz 23 von 1876: „Meiner[sic!] Mutter hatte alte Kleider von meiner Tochter herausgelegt.“ [Hervorhebung G. D.-S.] in Niedermendig, Polch, Allenz, Düngenheim, Virneburg nicht flektiert: ahl K., in Reudelsterz, Kürrenberg, Ochtendung steht dagegen ahle. ↩
- Vgl. hierzu Kapitel 9. ↩
- Die Singularformen weisen Tonakzent 2 (Wäi²n), die Pluralformen Tonakzent 1 (Wäi¹n) auf. ↩
- Ob die Formen tatsächlich apokopiert oder nicht gebeugt sind, ist nicht zu entscheiden. Zur Apokope vgl. Kapitel 4. ↩
- Vgl. Kapitel 3 zu den Mayener Mitlauten. ↩
11. Personalpronomen
Ésch, dau, e, se, et, mir, ihr, se. E, ää, er, en, hie. És hie / säi / it dòò? Jéwwet imm. Et Gaby és nét dòò. Et és e goot Mönsch. De Fröllein Schäfer. Dat Diederéschs Mädsche. Von den Personalpronomen / persönlichen Fürwortern
Das Personalpronomen ist ein Fürwort, das stellvertretend für eine Person oder eine Sache steht. Im Mayener Platt heißen sie im Nominativ ésch, dau, e, se, et, mir, ihr, se. Im Unterschied zur Standardsprache haben sie für Nominativ, Dativ und Akkusativ nicht jeweils nur eine Form. Es gibt im Platt volle Formen, die betonen oder Nachdruck verleihen und die weitgehend den standardsprachlichen entsprechen, und schwache, lautlich reduzierte, die bei neutralen Aussagen gebraucht werden. Der Genitiv ist zu vernachlässigen, da er praktisch nicht existiert. Ein (konstruiertes) Beispiel wäre aber mäiner Sill! ‘meiner Seele!‘
Die Formen für die verschiedenen Fälle lauten wie folgt:
| SINGULAR | 1. Pers. | 2. Pers. | 3. Pers. |
|---|---|---|---|
| Nom. | ésch | dau, de | e, er, ä, en, hie (der, däa) se, säi (dee) et, it (dat) |
| Dat. | mir, ma | dir, da | imm, em (demm) Ihr, a (der) imm, em (demm) |
| Akk. | mésch | désch | inn, en (denn) säi, se (dee) it, et (dat) |
| PLURAL | 1. Pers. | 2. Pers. | 3. Pers. |
|---|---|---|---|
| Nom. | mir, ma | ihr, a (dihr) | se (säi)*, (dee) |
| Dat. | us | eusch | inne, en (denne) |
| Akk. | us | eusch | se (dee) |
Das Personalpronomen der 1. Pers. Singular lautet für den Nominativ ésch, z. B. Ésch jinn haam. ‘Ich gehe heim‘, Dat wòrésch nét! ‘Das war ich nicht!‘, Bórümm da ümmer ésch? ‘Warum denn immer ich?‘ oder auch verkürzt: Éjóch ‘Ich auch‘, Éjaawer! ‘Ich aber!‘ Im Dativ heißt es mir (Vollform), z. B. Jéff et mir! ‘Gib es mir!‘, und ma (schwache Form), z. B. Jéffet ma her! ‘Gib es mir her!‘, und für den Akkusativ mésch, z. B. Dat és aanfach für mésch. ‘Das ist einfach für mich.‘, Ésch s´öll mésch nét ófrääje. ‘Ich soll mich nicht aufregen‘, oder auch Kannsde méjóch sehn? ‘Kannst du mich auch sehen?‘.
In der 2. Pers. Sg. Nominativ kommt ‘du‘ in der vollen Form dau und der schwachen, lautlich reduzierten Form de
vor, z. B. Waaß dau dat? oder Waaß de dat? ‘Weißt du das?‘.
Im Dativ heißt es z. B. Ésch jénn et dir morje. oder Ésch jénn et da morje. ‘Ich gebe es dir morgen.‘ Der
Akkusativ désch, z. B. Dat és aanfach für désch. ‘Das ist einfach für dich.‘ oder auch Ésch kann désch sehn.
‘Ich kann dich sehn‘. Ésch kann déjóch sehn. ‘Ich kann dich auch sehen‘.
‘er‘ e, ää, er, en, hie
Das Mayener Platt hat für die standardsprachliche 3. Pers. Sg. maskulinum ‘er‘ im Nominativ die Formen: e [ə], in
Anlehnung an ein vorhergehendes Wort auch a [a], en [ən], hie [hiː²]. In der Literatur tauchen auch er [ɛa] und
ää [ɛː²] auf, die als Schreibvarianten gesehen werden. Für Personen können alle Formen gebraucht werden, en [ən]
aber nicht in jeder Satzposition. Beispiele sind E és dahaam. ‘Er ist daheim.‘ E és óf de Maat. ‘Er ist zum
Markt (gegangen); wörtl. er ist auf den Markt‘ oder „Ohmens an da Dür söht er dann zo ihr“ ‘Abends an der Tür
sagt er dann zu ihr‘, „Er röckt janz nägst erann“ ‘Er rückt ganz nächst (=nah) heran‘, „er reed vill Quatsch
onn Mest“ , „Ä fäutelt be en Höhnerdeev“ ‘Er schummelt wie ein Hühnerdieb‘, „on eß ä morgens schlächt gemötscht,
dann laift ä langst de Schull.“ ‘und ist er morgens schlecht gemützt (=schlecht gelaunt), dann läuft er langst
die Schule (= läuft er an der Schule vorbei). Für Sachen heißt es E/ Er staht ó’m D´ösch. ‘Er steht auf dem
Tisch‘ [der Teller, der Zucker, der Stuhl, der Schuh, ...]. E/ Er läit én da Schubbelaad. ‘Er liegt in der
Schublade.‘ und „On wäider verzellt de Bur jemäschlesch, bat er su hürt on säiht alldäglesch“ ‘Und weiter
erzählt der Brunnen gemächlich, was er so hört und sieht alltäglich‘. Für die Form en [ən] für ‘er‘ im
Nominativ, die wörtlich ‘ihn‘ bedeutet , die also ein Akkusativ ist, gilt, dass sie niemals am Satzanfang
vorkommt, sondern in unbetonter mittlerer und finaler Satzposition. En wird für Personen und Sachen
gleichermaßen gebraucht, z. B. És en dahaam? ‘Ist er daheim?‘ Am Sunndaach kümmt en. ‘Am Sonntag kommt er.‘
Lòh stahden (sowohl der Teller als auch der Mann, der Vater, der Junge, Opa, Peter). „Onn jef ihm batt en well,
dann ess en widder stöll“ ‘und gib ihm was er will, dann ist er wieder still‘. E und en können, da sie lautlich
reduziert sind und ihnen keine Emphase verliehen werden kann, nicht isoliert stehen, was bedeutet, dass die
Antwort auf eine Frage nie E oder En sein kann - nicht bei Personen und nicht bei Sachen.
Gern wird statt des Personalpronomens der Artikel ‘der‘, der [dɛ²ɑ] -schriftlich auch dää, dä [dɛː²], däa
[dɛ²ɑ] - gebraucht, so dass es Der és dahaam. ‘Der ist daheim‘. Bó wéll der da hin? ‘Wo will der denn hin?‘,
Der és óf de Maat. ‘Der ist zum Markt (gegangen); wörtl. der ist auf den Markt‘, Der és nét pur! ‘Er ist
verrückt; wörtl.: der ist nicht pur!‘ De Mórje wòr der bäi de Dógder. ‘Heute Morgen war der zum Arzt; wörtl.:
den Morgen war der bei den Doktor.‘ Der staht ó’m D´ösch. ‘Der steht auf dem Tisch‘ [der Teller]. Der läit én
da Schubbelaad. ‘Der liegt in der Schublade.‘ und „Däa mohs bestemt vom Gas- onn Wasserwerk her säin“ ‘Der muss
bestimmt vom Gas- und Wasserwerk her sein‘. „Dä well soß nergens wonne“ ‘Der will sonst nirgends wohnen‘, „Dä
kann kah Roh mieh hale“ ‘Der kann keine Ruhe mehr halten‘ heißt.
Das Mayener Platt hat für ‘er‘ noch die alte heute aber zunehmend ungebräuchliche Form hie bewahrt. Hie wird
nicht nur gesprochen wie das englische he, sondern, hier zeigt sich die sprachliche Verwandtschaft. Es handelt
sich tatsächlich um dasselbe Wort, das auf westgermanisch *hē zurückgeht. Seine Verwendung ist ganz speziell:
Hie bezeichnet nicht irgendeinen ‘er‘, sondern außschließlich den Hausherrn, „den Chef des Hauses“. Im
RHEINISCHEN WÖRTERBUCH (2, 141) heißt es hierzu: „Das Pron. dient auch als Bezeichnung des Hausherrn [...],
z. B. statt minge Mann wellt et net han sagt die gewöhnliche Frau: he wellt et net han; es he dohem?“ Das Beispiel ist kein Mayener Platt. Dadurch
ist unmittelbar klar, wer gemeint ist, und Missverständnisse sind ausgeschlossen. Falls jüngere und ältere
Männer im selben Haushalt wohnen, gilt die Frage És hie dòò? nur dem Hausherrn und gern ist die Hervorhebung
auch ein wenig scherzhaft gemeint. Hie kann in jeder Satzposition vorkommen: Bó és hie? bedeutet also nicht
einfach ‘Wo ist er?‘, sondern ‘Wo ist (denn) der Hausherr, das „Familienoberhaupt“?‘És hie dahaam? ‘Ist der
Hausherr daheim?‘ Hie és jaa nét dòò. ‘Der Hausherr, „Chef“ ist gar nicht da.‘ Hie als volle, starke Form kann
auch allein stehen: Ber wòr da dahaam: Säi oder hie? Hie! ‘Wer war denn daheim: Sie oder er? Er! (d. h. die
Hausherrin oder der Hausherr?)
Für das standardsprachliche Personalpronomen ‘ihm‘ für die 3. Pers. Sg. mask. Dativ hat das Mayener Platt die
starke, volle Form imm [i¹m] und die reduzierten em [əm], 'm [m]. So heißt es z. B. Jewwet imm! ‘Gib (wörtl.:
geb) es ihm (und keinem andern)!‘ Ésch wéll mét imm schwätze! ‘Ich will mit ihm (und mit keinem andern)
sprechen!‘ Dat és imm. ‘Das gehört ihm; wörtl.: Das ist ihm.‘ Dat és imm säint. ‘Das gehört ihm. /Das ist
seins; wörtl.: Das ist ihm seins.‘, Dat és imm säi Módder. ‘Das ist seine Mutter.; wörtl.: Das ist ihm seine
Mutter.‘ Beispiele für die schwache Form sind: Borümm hasdem daa neust jesòòt? ‘Warum hast du ihm denn nichts
gesagt?‘, Jéwwedem. ‘Gib es ihm.‘ Ma hannet em at praacht. ‘Wir haben es ihm schon (wörtl. all) gebracht.‘ Et
wòrem ze warm. ‘Es war ihm zu warm, z. B. Peter oder dem Hund.‘
So, wie im Nominativ gern der Artikel ‘der‘ statt Pronomen verwendet wird, wird auch im Dativ der Artikel:
demm ‘dem‘ gebraucht. Er kommt nur in der Vollform vor: Dat és demm. ‘Das gehört ihm; wörtl.: Das ist dem.‘,
Dat és demm säint. ‘Das gehört ihm; wörtl.: Das ist dem seins.‘, Jewwet demm! ‘Gib es ihm; wörtl.: Geb es dem!‘
, wobei auf den Betreffenden gedeutet wird.
Für das standardsprachliche ‘ihn‘, den Akkusativ, gibt es im Mayener Platt inn, die Vollform, die ausschließlich für Personen gilt, en und, als „Ersatz“, den Artikel ‘den‘: denn. Beispiele für die volle, starke Form sind: De mooß inn anroowe, doch nét säin Frau! ‘Du musst ihn anrufen, doch nicht seine Frau!‘ Auch, wenn der Hausherr, der „Chef“, gemeint ist, heißt es: Hasde inn jesehn? ‘Hast du ihn gesehen?‘ Inn hann ésch jesder jetróff. ‘Ihn habe ich gestern getroffen.‘ Beim nicht hervorgehobenen Gebrauch heißt es en - gleichermaßen für Personen und Sachen: Ma prauren en nét aafzehólle. ‘Wir müssen ihn nicht abholen; wörtl.: Wir brauchen ihn nicht abzuholen‘. Säihsden? ‘Siehst du ihn (den Mann / den Hund / den Schlüssel)?‘ Ésch sehn en nét. ‘Ich sehe ihn nicht (den Mann / den Hund / den Schlüssel).‘ Dau sóllts en doch métprenge! ‘Du solltest ihn doch mitbringen!‘ Hasden funne? ‘Hast du ihn gefunden?‘, Stell en óf de D´ösch! ‘Stell ihn auf den Tisch!‘ oder Ääs en doch! ‘Iss (wörtl. ess) ihn doch!‘ Auch hier wird häufig der Akkusativ-Artikel denn ‘den‘ gebraucht: Dau mooß denn aas anrowe! ‘Du musst ihn (wörtl.: den) mal anrufen!‘ oder Denn hannéjat lang nimmie jesehn. ‘Ihn (wörtl.: den) habe ich schon lange nicht mehr gesehen.‘, Ésch hann denn én da K´ösch funne. ‘Ich habe den in der Küche gefunden.‘ was sich auf eine Person oder eine Sache beziehen kann.
‘sie‘ säi, se
Der 3. Pers. Singular femininum *sie‘ entspricht im Mayener Platt für Personen und Sachen das lautlich schwache se , und zwar in jeder Satzposition. Es heißt am Satzanfang: Se és nét dahaam. ‘Sie ist nicht daheim (die Frau, die Mutter, die Oma).‘, in mittlerer Satzposition: Wann és se daa fott? ‘Wann ist sie denn fort (gegangen) (die Frau, die Mutter, die Oma)?‘ und am Satzende: Lòh staht se. ‘Dort steht sie (die Frau, die Mutter, die Oma, die Katze).‘ Se kann genau so wenig, wie es die schwachen männlichen Formen e, ä und en können, allein stehen. Auf z. B. Ber wòr dat? ‘Wer war das?‘ muss die Antwort de Oma, de Frau XY, Tant Kädda oder speziell: säi lauten. Beispiele für Sachen sind: Se és kabótt. ‘Sie ist kaputt (etwa die Tasse, die Uhr).‘ Lòh staht se. ‘Da (wörtl.: allda) steht sie‘. Ésse leer? ‘Ist sie leer (die Tasse)?‘ Die volle Form säi, die wohl auch im Gebrauch zurückgeht, ist das Pendant zum männlichen hie und wird speziell für die „Hausherrin“, die Frau, die im Haus das Sagen hat, verwendet. Wenn säi fottjange és, ist klar, dass es die Hausherrin ist – nicht die Tochter und nicht eine andere im Haus wohnende Frau. Hat säi dat jesòòt? ‘Hat die Hausherrin, das gesagt?‘, Dat wòr säi! ‚Das war die Hausherrin (, die das getan hat).‘ Säi kann, wie hie, in jeder Satzposition gebraucht werden und als volle Form auch allein als Antwort auf eine Frage stehen: Säi. Auch beim Femininum wird statt des Pronomens gern der Artikel verwendet, so dass es statt Se és nét dòò. Dee és nét dòò ‘Die ist nicht da.‘, statt Se és óf de Maat. Dee és óf de Maat. ‘Die ist zum Markt (gegangen); wörtl. die ist auf den Markt‘, statt Bo ésse daa? Bó és dee daa? ‘Wo ist die dann?‘ heißt und És dee nét dòò? ‘Ist die nicht da?‘, Dee staht ó’m D´ösch. ‘Die steht auf dem Tisch‘. Dee läit én da Schubbelaad. ‘Die liegt in der Schublade.‘
Auch hier gibt es eine volle (nur für Personen) und eine schwache Form (auch für Tiere). Die Vollform im Wem-Fall heißt wie in der Standardsprache ihr ‘ihr‘, z. B. E s´öll et ihr én de Hand jénn. ‘Er soll es ihr (der Frau, der Mutter, der Oma) in die Hand geben.‘, Ma können et ihr nòhher verzélle. ‘Wir können es ihr nachher erzählen.‘ Und wie in der Standardsprache entscheidet über Hervorhebung die Betonung. Die schwache Form a kommt oft, aber nicht ausschließlich gebunden vor , z. B. Se hanneda métpraacht. ‘Sie haben es ihr (der Frau / der Mutter / der Oma) mitgebracht.‘ Ma hanna heude Méddach de Zäidung praacht. ‘Wir haben ihr heute Mittag die Zeitung gebracht. ‘ Wéllsde a nét nòhjòhn? ‘Willst du ihr nicht nachgehen?‘ Dat ésa doch nét. ‘Das gehört ihr (wörtl.: ist ihr) doch nicht (der Tochter / der Katze).‘ Ésa dat éjal? ‘Ist ihr das egal?‘
Der Akkusativ ist identisch mit dem Nominativ: se, z. B. Hóll se aas! ‘Hole sie einmal (die Frau, die Mutter, die Oma und auch die Katze, die Tasse, die Tablette, die Zange).‘ . E säiht se. ‘Er sieht sie (die Frau, die Mutter, die Oma und auch die Tasse, die Tablette, die Zange).‘ Der Akkusativ-Artikel ist ebenfalls möglich: Hóll dee aas! ‘Hole die einmal (die Frau, die Mutter, die Oma und auch die Tasse, die Tablette, die Zange, ...).‘ E säiht dee nét. ‘Er sieht die (die Frau, die Mutter, die Oma und auch die Tasse, die Tablette, die Zange) nicht.‘ Für die „Hausherrin“ heißt es: Jangk säi aas hólle! ‘Geh sie, die Hausherrin, einmal holen!‘ Hasde säi óch jesehn? ‘Hast du sie, die Hausherrin, auch gesehen?‘
‘es‘ et, it
Dem standardsprachlichen Personalpronomen für die 3. Pers. Sing. Neutrum, ‘es‘, entspricht im Mayener Platt in
jeder Satzposition et: Im Nominativ heißt es: Et és neu. ‘Es ist neu.‘, z. B. das Auto.‘ Läit et ó’m Stohl?
‘Liegt es auf dem Stuhl?‘ Lòh és et. ‘Da ist es.‘ Bó és et? ‘Wo ist es?‘, z. B. das Handtuch. Ésch hann et
ääwe noch jesehn! ‘Ich habe es eben noch gesehen!‘
Das Personalpronomen et wird aber nicht nur als solches eingesetzt, sondern hat fest die Stelle des sächlichen
Artikels ‘das‘ eingenommen, es ist gleichermaßen zum Artikel geworden. Aus diesem Grund ist der Artikel
Fällen, in denen Nachdruck auf etwas gelegt oder etwas anschließend erläutert wird, vorbehalten. Es heißt also
im normalen unbetonten Gebrauch et Audo, et Fisder, et Booch, et Messer und nicht dat Audo, dat Fisder, dat
Booch, dat Messer. Es heißt Ésch jinn én’t Kino. ‘Ich gehe in es Kino.‘ Setz désch én’t Audo. ‘Setz dich in es
Auto.‘ Auch, wo z. B. standardsprachlich eine Konstruktion mit ‘zum‘ gebraucht wird, hat das Mayener Platt et:
E kuckt et Fisder raus. ‘Er sieht zum Fenster hinaus; wörtl. er guckt es Fenster heraus.‘
Eine Besonderheit des Mayener Platts, die sehr auffällt, ist, dass es als moselfränkischer Dialekt, wozu auch
das Luxemburgische zählt, ebenso wie das Ripuarische, et als Pronomen bzw. als Artikel nicht nur für
Unbelebtes, Sachen und Kinder, sondern auch für Mädchen und Frauen gebraucht. Das RHEINISCHE WÖRTERBUCH
(2,175 f.) weiß: „Jedes Kind u. Mädchen wird mit es (et, het) bezeichnet“. Um genau zu sein: Jedes „Mayner
Mädsche“ ist im Mayener Platt bis zum Lebensende et – nur nicht für jeden.
Im Mayener Platt heißt es et Chrisdine, nicht die Christine, et Anni, nicht die Anni. Wie oben gezeigt, ist et
der ganz normale, nicht abwertende Artikel, das ganz normale, nicht abwertend gebrauchte Personalpronomen: Et
és nét dòò! ‘Es ist nicht da!‘, z. B. et Anni. Häi és et Chrisdine! ‘Hier ist es Christine! So ist auch die
Variante die der Umgangssprache - im echten Platt heißt es nur et - nur scheinbar das Pendant zu et, da auch
die, wo das Mayener Platt die schwache Form de hat, demonstrativ ist. Gerne wird bei der Übertragung vom Platt
ins Hochdeutsche, oder korrekt: in die Umgangssprache et Gaby mit ‘das Gaby‘, wiedergegeben, z. B. „Hallo Oma,
häi éset Gaby!“ ‘Hallo Oma, hier ist *das Gaby!’. Auch dies entspricht nicht dem Mayener Platt und wird dem
Sinn keinesfalls gerecht , da et Chrisdine, et Anni semantisch nur näherungsweise als ‘die Christine‘, ‘die
Anni‘ in der Umgangssprache zu interpretieren sind.
Vielmehr nimmt et semantisch eine Stellung zwischen dem artikellosen ‘Christine‘, ‘Anni‘ und ‘die Christine‘,
‘die Anni‘ ein – dem Sinn nach deutlich näher beim standardsprachlichen Gebrauch ohne Artikel. Et ist als
Artikel extrem schwach und semantisch gesehen so gut wie „Null“, wie nicht vorhanden, und es sollte bei einer
Übertragung am besten weggelassen werden. Wenn es ‘das Gaby‘ heißen soll, dann sagt der Mayener auch ‘das
Gaby‘ – dat kennt das Mayener Platt ja. (Analog ist das bei de /der Ingo und de /dee Módder genauso.) Nach
Vorerwähnung, Bo éset Gaby? Dat és häi! ‘Wo ist es Gaby? Das ist hier.‘, sind et und dat möglich (in dem Fall
fast ohne Nachdruck). Die Verwendung von ‘das‘ ist immer mehr oder weniger demonstrativ. Mit dat wird etwas
spezifiziert: 1. wird jemand näher bestimmt, z. B. Dat Margret, dat én da Jerwerstròòß wónnt. Wörtlich: ‘Das
Margret, das in der Gerberstraße wohnt.‘, 2. wird jemand abgewertet, z. B. Dat Kädda, dat és en schlau M´ösch!
‘Das Kätta, das ist raffiniert; wörtl. eine schlaue Müsche (=Spatz)!‘ oder 3. sich von ihm distanziert, z. B.
Bat dat Karinn jesòòt hat, jefällt ma jaa nét! Wörtlich: ‘Was das Karin gesagt hat, gefällt mir gar nicht!‘.
4. dient dat zur Bekräftigung, z. B. Dat Hannah, dat és e goot Mönsch / e leef Kénd! Wörtlich: ‘Hannah ist
herzensgut /ein liebes Kind. Wörtl.: Das Hannah, das ist ein gut(es) Mensch / ein lieb(es) Kind!‘
Dem männlichen hie und dem weiblichen säi entsprechend, gibt es im Neutrum die starke, volle Form it, die in
der Umgangs- und Standardsprache kein Gegenstück hat: It és dahaam. ‘Es ist daheim.‘És it fott? ‘Ist es fort?
‘Bó és it? ‘Wo ist es? ‘ Mit it wird wie mit säi nach der Frau, die das Sagen hat gefragt, wenn diese von dem
Fragenden mit Vornamen angesprochen wird. Die Antwort auf die Frage: Ber wòret? kann z. B. lauten: It! It kann
allein stehen und obwohl es an den Vornamen gebunden ist, kann es nicht mit diesem zusammen, was bei et
wiederum zwingend ist, gebraucht werden: *it Christine. Als Relativpronomen kann et nicht eingesetzt werden:
Et Flora, *et és mööd. ‘Flora, *es ist müde.‘ Oder: Et Tina, *et és ó’m Balgoon. ‘Tina, *es ist auf dem Balkon.‘
In diesem Fall muss es dat heißen: Et Flora, dat és mööd.
Ebenso wie in der Standardsprache heißt das Dativpronomen für die 3. Pers. Sg. Neutr. ‘ihm‘ mit den Formen imm und em (‘m). Verwendet wird es wie z. B. mit der vollen Form ohne Vornamen in: Dat és imm. ‘Das gehört ihm (z. B. Tina, dem Kind).‘ Dat Booch schenggen ésch imm. ‘Das Buch schenke ich ihm (Tina und nicht jemand anderem).‘ Mit dem Vornamen zuammen wird die schwache Form gebraucht: Dat Booch schenggen ésch em Claudi. ‘Das Buch schenke ich Claudi.‘ Das Akkusativpronomen lautet wie in der Standardsprache ‘es‘et, z. B. Ésch hóllen et. ‘Ich hole es (Claudi, das Buch, das Kleid, das Kind)‘.
Näheres zur Sicht von et und dat jenseits des Moselfränkischen
Die regionale Verbreitung des Gebrauchs von et bzw. dat bei weiblichen Vornamen in der Umgangssprache ist mittlerweile einigermaßen bekannt. Dies zeigt die folgende Karte:
Artikelform
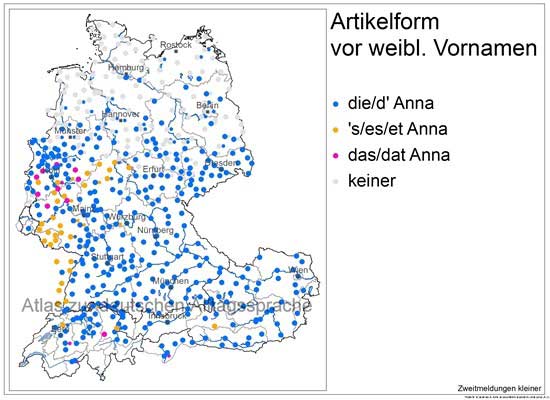
Atlas zur deutschen Alltagssprache: Artikelform vor weiblichen Vornamen (Frage 2e)
Es handelt sich hier zwar um eine Karte zur Alltagssprache, aber man darf wohl davon ausgehen, dass et bzw. dat
als Artikel im Platt nicht weniger weit verbreitet ist und als Pronomen auch nicht. Es darf auch als gesichert
gelten, dass et als Pronomen für weibliche Personen sehr alt ist. Wieso aber bei Mädchen bzw. Frauen et und
dat gebraucht werden, ist unbekannt.
Als Ursprung für den Gebrauch von et und dat bei Mädchen und Frauen wird in der Sprachwissenschaft einerseits
die Übertragung des et von diminuierten, also verkleinerten Vornamen, z. B. in Mayen et Ruthchen, auf
nichtdiminuierte Vornamen, z. B. et Roswitha, diskutiert , d. h. die Übertragung auf Mädchennamen generell.
Andererseits gilt als möglich, dass neutrale Bezeichnungen für Frauen, wie ‘das Mädchen‘, ‘das Fraumensch‘,
‘das Weib‘ und ‘das Mensch‘, ihren Artikel auf Vornamen übertragen haben. Belege gibt es weder für die eine
noch die andere Vermutung.
Obwohl der Ursprung von et und dat bezogen auf Mädchen und Frauen völlig unbekannt ist, erhitzt deren Gebrauch für nicht mehr (ganz) kleine Mädchen und für Frauen die Gemüter jenseits des moselfränkischen und ripuarischen Sprachraums. Es herrscht offensichtlich die Vorstellung, moselfränkische und ripuarische Frauen werden durch die Verwendung des sächlichen Artikels herabgesetzt, so, als werden sie wie eine Sache, ein Ding behandelt. Dabei wird aber die Unterscheidung, dass es sich bei et bzw. dat um das grammatische Geschlecht und nicht um das biologische Geschlecht handelt, aus welchen Gründen auch immer, unterlassen oder als nicht relevant betrachtet, d. h., das biologische Geschlecht wird mit dem grammatischen gleichgesetzt. So gelten denn auch speziell die Bezeichnungen ‘das Mädchen‘, ‘das Fräulein‘ und ‘das Weib‘ und besonders auch die oben genannten ‘das Fraumensch‘ und ‘das Mensch‘ als herabsetzend. ‘Das Weib‘, ‘die Frau‘ und ‘der Mensch‘, haben seit althochdeutscher Zeit, und zwar gut 1000 Jahre lang (bis ins 18. Jh.), ohne jeden abschätzigen Sinn nebeneinander existiert. Das Mayener Platt hat deren Bedeutungen von vor hunderten von Jahren bewahrt, wie die Etymologie zeigt. ‘Mädchen‘, also e Mayner Mädsche, wird zumindest von der Sprachwissenschaft wegen seines Artikels ‘es‘, noch dazu fälschlich mit 'das' (s.o.) wiedergegeben, als abschätzig gedeutet, wenn es sich nicht auf Kinder bezieht. Im Gegenteil: Das „Mayener Mädsche“ und der „Mayener Jung“ sind Symbolfiguren und aus Mayener Stein gehauen auf dem Marktplatz zu bewundern. Zum abschätzigen Gebrauch von ‘Mädchen‘ wird gerade nicht die Verkleinerung verwendet wird, sondern: Ésch säin doch nét däin Määd! ‘Ich bin (wörtl. sein) doch nicht deine Magd!‘ Der Artikel von Magd ist feminin. Neben den Begriff ‘der Mensch‘ tritt in mittelalterlicher Zeit ‘das Mensch‘: „mhd. mensche, mensch m. n. ‘Mensch, Mädchen, Buhlerin, Magd, Knecht, das menschliche Geschlecht’“. Beide stehen „bis ins 17. Jh. ohne abschätzigen Sinn“ nebeneinander. ‘Das Mensch“ bedeutet „seit dem 15. Jh. häufig eine ‘weibliche Person’, besonders die ‘Magd’“, was wohl nicht per se negativ gedeutet werden darf. Es „wird seit dem 18. Jh. durchgehend abwertend gebraucht“. In der Tat kann man auch im Mayener Platt jemanden mit suu e Mönsch herabsetzen, aber nur recht schwach. Da hat das Mayener Platt ganz andere Möglichkeiten. Stattdessen ist aber dat Mönsch entweder ganz überwiegend Ausdruck höchster Bewunderung und Anerkennung oder aber es beschreibt z. B. besondere Gutherzigkeit, etwa It és e goot Mönsch! ‘Es ist eine herzensgute Frau!‘. So heißt es im RHEINISCHEN WÖRTERBUCH (5, 1081, 2): „Frauensperson im allg. Sinne, nicht verächtl., bes. mit ehrenden Beiwörtern; en got, lef, stolz, gruss, arm (nicht reich, bedauernswert) M.; wat e schün M.; meng Schwester es e nett M.; en alt M. (zu bemitleiden) (udgl.) Rip, Allg. — E lef Menschelche liebes, nettes Mädchen als Kind“, und zwar unabhängig vom sozialen Status. Dass ‘Weib‘, das viele Jahrhunderte ohne abwertende Bedeutung neben Frau existiert hat, heute auch in Mayen ein Schimpfwort ist, steht außer Frage. Die Bezeichnung ‘das Weib‘, „‘erwachsene weibliche Person, Ehefrau’“, ist schon im 8. Jh., also in althochdeutscher Zeit, nachgewiesen, wobei die Herkunft ungeklärt ist.
Im Deutschen hat „ahd. frouwa ‘Herrin’ (9. Jh.)“ , das eine weibliche Ableitung „zu ahd. frō ‘Herr’“ ist (heute noch in Frondienst, Fronleichnam), mit der Zeit ‘das Weib‘ verdrängt, das dadurch die bekannte Bedeutungsverschlechterung erfahren hat. Im Englischen dagegen hat sich ahd. wīb (8. Jh.), heute wife für Ehefrau durchgesetzt. Daneben steht generell für Frau woman. Woman ist aus altenglisch wīfmann entstanden und heißt eigentlich ‘Weibsmensch’ - auf Mayener Platt dat Fraumönsch ‘das Fraumensch‘. Hierzu findet sich im RHEINISCHEN WÖRTERBUCH (2, 752): „Allg.bezeichnung für Frau, nicht nur verheiratet“, „im allg. nicht verächtl.“. Mit dat Fraumönsch wird im Mayener Platt große Bewunderung ausgedrückt, z. B., wenn etwas Schwieriges unerwartet gut gelungen ist, z. B. Nau kuck aas aaner an! Dat Fraumönsch! ‘Nun sieh mal einer an! Diese Frau!‘ Abwertung ist mit Fraumönsch allerdings stärker möglich als mit dat Mönsch: Dat és e treggésch Fraumönsch! ‘Das ist eine böse (wörtl.: dreckige) Frau!‘. Das Pendant Mannskerl(e) oder auch Mannsleut ist allerdings nie bewundernd gemeint, sondern bedeutet so viel wie „Männer!“.
Nicht nur die Herkunft, sondern auch die Verwendung von et / dat bzw. sie ist der Sprachwissenschaft unklar,
und es wird erforscht, welcher Frau welches Pronomen zugeteilt wird, als gebe es ein Et-sein und ein
Nicht-et-sein, eine feste Kopplung an eine Frau: exlusiv et oder sie. Dabei wird zumindest z. T. von der
Annahme ausgegangen, et bezeichne „allesamt Mädchen, unverheiratete Frauen oder Frauen im Allgemeinen, wenn
der Sozialstatus nicht besonders betont wird oder dieser niedrig ist (wie zum Beispiel bei
MädcheΫDienstmagdά)“. Dagegen ist es schlicht so, wie es im RHEINISCHEN WÖRTERBUCH (2, 177) steht:
„Weibl. Vornamen haben es, et als Artikel, z. B. et Ann, et Marie, ob verheiratet oder nicht“
(Hervorhebung G. D.-S.).
Da es auch in Mayen Usus ist, sich auf Mädchen und Frauen und Jungen und Männer, die man duzt, mit dem
Vornamen zu beziehen, und da dies, anders als in der Standardsprache, niemals ohne Artikel geschieht (i. d.
R. die schwache Form), et Claudi. et Tina, de Jürgen, de Tobias, und et bzw. dat und de im Platt die
einzigen Artikel sind - die Anrede ist natürlich ohne Artikel -, ergibt sich, dass et nicht an ein Mädchen
oder eine Frau, nicht an eine Person, sondern an deren Vornamen gekoppelt ist, und zwar ausschließlich.
Zumindest bis in die 70er Jahre wurde auch in die Umgangssprache einzig dieses dialektale et übernommen.
‘Sie‘ oder auch ‘die‘ dagegen wird im Platt(!) nie zusammen mit dem Vornamen gebraucht, da weibliche
Vornamen ja kein die haben. Mit ‘die‘ (auch hier i. d. R. die schwache Form) bezieht man sich einerseits
auf fremde Frauen (de Frau Schwarz, de Frau Orth) und andererseits auf Frauen, wenn der Vorname nicht
gebraucht wird, z. B. de Mamma, de Oma, (de Preefträjerin, de Zäidungsfrau). Es ist daher keinesfalls so,
dass man im Platt die Wahl zwischen dem sächlichen und dem weiblichen Artikel hat.
Da einer Frau ihr Vorname im Lauf des Lebens nicht abhandenkommt, ist es weder rätselhaft noch
verwunderlich, dass man sich mit ihm auch lebenslang auf sie bezieht. Man hört nicht irgendwann im Leben
auf, et Klara et Klara zu nennen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hat, sondern tut das auch noch,
wenn et Klara 90 Jahre ist. Die, die sie siezen sagen selbstverständlich Frau Schmidt, wenn sie sich auf
sie beziehen und, anders als beim et, das keine Anrede ist, auch wenn sie sie ansprechen. Der Gebrauch von
et und sie ist jedenfalls im Mayener Platt weder geheimnisvoll noch komplizert, sondern höchst simpel:
Diederéschs Gaby és verhäiròòt ón hat zwei erwachsene Kénner: de Tobias ón et Hannah. Et hat träi
Enggelscher: De Benji, de Simon ón et Flora. Et és denne ihr Oma, de Oma Gaby. Für em Gaby säi
Schwiejermódder, denne träi ihr Uroma Klara, és et et Gaby. Dee és et Klara. Jenausu és et Gaby für säin
ón et Klara für säin Freundinne „Et“.
Das Beispiel zeigt: Eine Frau ist immer beides: et und sie! Es gibt nicht et- oder sie-Frauen, nicht anders
als jenseits des Moselfränkischen und Ripuarischen – wie könnte es anders sein –, nur, dass es dort sie
bzw. die heißt. Heirat ändert evtl. einen Namen, hat aber null Einfluss auf die Bezeichnung mit et oder
sie. Der Irrtum der Sprachwissenschat, et bedeute unverheiratet und sie verheiratet, mag daher rühren, dass
ihr entgangen ist, dass im Moselfränkischen und Ripuarischen die verheiratete Frau die Zugehörigkeit zu
ihrer Herkunftsfamilie lebenslang behält und nicht der angeheirateten Familie des Mannes zugeordnet wird.
Das bedeutet, sie wird von Mayenern über ihren Geburtsnamen identifiziert. Kennt man diesen, weiß man, mit
wem man es zu tun hat. Fremde können natürlich nicht erkennen, ob es der Geburtsname oder der angeheiratete
Name ist. Dass man die betreffende Frau duzt, kann der Fremde allerdings am vorausgestellten Familiennamen
schon merken.
Eine Frau, die man als verheiratete Frau kennengelernt hat und deren Herkunftsfamilie einem unbekannt ist,
z. B. weil sie zugezogen ist, ist de Frau Mohr, de Frau Lange, de Frau Stein oder de Frau Wilbert, so lange
man sich siezt. Duzt man sich, wird sie zu Mohrsch Hedwisch, Langes Gisela, Steins Käddi, Wilbertse
Annemie und zu et: et Hedwisch, et Gisela, et Käddi, et Annemie.
Die Bezeichnung bzw. Anrede ‘Frau‘ ist natürlich im Mayener Platt nicht anders als in der Standardsprache
bis in die 70er Jahre diejenige für die verheiratete fremde Frau, die man siezt, de Frau Schröder, de Frau
Pitoll, da Höflichkeitsregeln bzw. Gepflogenheiten durch eine bestimmte Varietät (Sprechlage), Dialekt,
Umgangssprache oder Standardsprache, weder eingeführt noch außer kraft gesetzt werden. Das grammatische
Geschlecht ist das feminine – in der Anrede das für fremde Personen gebrauchte distanzierende ‘Sie‘: Frau
Domke, Frau Meulemann, Frau Schmidt.
Aus dem Gebrauch von et auf Unverheiratetsein, Mädchen sein und geringes Ansehen schließen zu wollen,
funktioniert in Mayen nicht. Belle Ina war sein Leben lang Belle Ina – und wenn es zehnmal Frau Steiner
war!
Die Bezeichnung Fräulein, ursprünglich die „mhd. vrouwelīn ‘Herrin, Gebieterin, junge unverheiratete
Edeldame’ (vgl. ahd. jungfrouwilīn, Hs. 12. Jh.)“, ab dem „18. Jh. [...] allgemeine Bezeichnung für junge
unverheiratete Mädchen“, war im Platt, heute gibt es sie wohl nicht mehr, ebenso wie in der Standardsprache
die höfliche Bezeichnung bzw. Anrede (schriftlich oder mündlich) für die unverheiratete fremde Frau, d. h.,
für die, die gesiezt und folglich nicht mit dem Vornamen und daher auch nicht mit et angeredet wurde. Das
grammatische Geschlecht ist hier dasselbe wie das biologische, nämlich das feminine, so etwa de Fröllein
Schäfer, de Fröllein Gander, dr Fröllein Geisbüsch, de Fröllein Schwinning, de Fröllein Koltes, de Fröllein
Meshing u.v.m. (Dass die hier genannten sämtlich Lehrerinnen oder Sekrtärinnen waren, liegt daran, dass es
nur wenige Berufe für Frauen gab, in denen sie ihren Lebensunterhalt, worauf sie stolz waren, selbst
verdienen konnten.) In dem Fall, dass die Frau geduzt wird, kommt die Anrede oder die Bezugnahme Fräulein
gar nicht in Betracht, sondern es wird der Vorname mit Artikel gebraucht, z. B. Et Angnes! Sch`ö`öwersch
Angnes! Dat és e goot Mönsch! ‘(Es) Agnes! Schäfers Agnes! Das ist ein gutes Mensch!‘
Noch in den siebziger Jahren bezogen sich ältere Leute auf den (unverheirateten) Sohn einer Familie mit der
Sowieso-Jung (der Müllersch-Jung) und die (unverheiratete) Tochter einer Familie, mit dat Sowieso-Mädsche,
besonders, wenn man die Vornamen nicht kannte. Dies geschah ohne Wertung. Hätte man sie herabsetzen wollen,
hätte man sie Juffer ‘Jungfer‘ genannt. Die Bezeichnung dat Sowieso-Mädsche hat auch noch den ganz
praktischen Grund, weibliche Mitglieder einer Familie einfach auseinanderzuhalten: Dat Giefersch-Mädsche
steht für die Tochter der Familie, um die Mutter, z. B. Frau Giefer, Ina, von derTochter Giefer, Brigitte,
zu unterscheiden. Schließlich will man wissen, wer gemeint ist. Gibt es z. B. Frau Pingst „zweimal“, die
Frau und die Frau des Sohnes der Familie Pfingst, unterscheidet man zwischen der alten und der jungen Frau
Pingst.
Die sogenannten Verwandtschaftsnamen bereiten im Mayener Platt bezüglich ihres Genus‘ kein Problem, da das
et an den Vornamen gebunden ist. Uroma, Oma, Mama, Tante, Schwägerin, Kusine, Tochter, Schwester u. Ä. -
bei diesen Verwandtschaftsnamen gibt es nur das feminine grammatische Geschlecht. Es ist nicht wählbar.
(In der direkten Anrede wird selbstverständlich gar kein Artikel verwendet.) Es gibt nur de/ dee Uroma,
de/dee Oma, de Mamma (nur de, da es nur eine gibt), de/dee Tant (bei Tante wird der Artikel nur dann
verwendet, wenn der Vorname auch genannt wird: de Tant Kreedel wörtl.: ‘die Tante Gretel‘) Bei
Schw`ö`öjersch ‘Schwägerin; wörtl.: Schwägersche‘, Kusien, Doochder, Schwesder ist die Vollform eher
anzutreffen, da von diesen, wenn von ihnen gesprochen wird, eher etwas berichtet wird, also z. B. dee
Kusien vón säinem Vadder. Vornamen, die bei Uroma, Oma, Tante gebraucht werden können, haben auf das Genus
keinen Einfluss und es heißt de Uroma Klara, de Oma Gaby, (de) Tant Tina. Eine Ausnahme gibt es aber:
Anders als in der Standardsprache heißt es folgerichtig dat Klaan und nicht ‘die Kleine‘, wenn der Vorname
nicht gebraucht wird: Ber wòret? Dat Klaan ‘die Klein(e)‘ (nicht *et Klaan, was viel zu schwach ist).
Zum et bei Jungen: Das grammatische Geschlecht für Kinder, Jungen und Mädchen, ist in allen Sprechlagen des
Deutschen das Neutrum. Dass dies bei Jungen in der Regel nur für ziemlich junge gilt, ist ebenfalls in allen
drei Varietäten der Fall. Doch es ist nicht so, dass im Moselfränkischen gar keine Jungen mit et und dat
bezeichnet werden. Es gibt, zumindest im Kindergartenalter, noch häufiger et Karlsche, et Hänsje und et
Paulsche. Et Piddersche und et Gritsche sind Figuren einer auf Platt erzählten Gruselgeschichte, die der
Autorin aus Kindertagen bekannt ist. Diese beiden waren immerhin so alt, dass sie des Nachts allein im Wald
Holz suchen waren. Und et Piddersche läuft de Eijerunner bee e Dunnerwääder. ‘Peterchen läuft die Eich
(Straße in Mayen) herunter[sic!] wie ein Donnerwetter.‘ Mit em klaane Karl-Heinzje ist aber nicht in jedem
Fall ein Junge gemeint. ‘Rölfchens‘ finden sich gleich drei: Mit einem Rölfje wurde óf da Póljer Stròòß
gespielt (v.d.W.), der andere hat én da Jerwerstròòß Fußball gespielt (Sch.) und ist der Cousin der Autorin
und der dritte hat én da Maifeldstròòß jewónnt (Q.). Et Fränzje (W.) hieß auch noch nach seinem Abitur so
und et Jübbesje (V.) war ebenfalls schon erwachsen. Et Fränzje Sch. war ein ehemaliger Schulkamerad. Et
Töönsche (E.) gehörte zur entfernteren Verwandtschaft, der Neffe der Großmutter der Autorin, und hieß auch
mit 50 Jahren noch ‘es Tonichen‘. Der Schuster in der Stehbachstraße, óf da Stehwésch, bei dem die Schuhe
repariert wurden, war nur et Schöösdersche und der neue Pastor in der Herz Jesu-Kirche war e fäi Pasdürsche.
Der Kottenheimer Heimatdichter und Sänger Paul Eultgen 1919 -1989 war (sozusagen) sein ganzes Leben in
Mayen nur als et Kóddemer Paulsche bekannt. Ein weiterer Mayener hatte einen diminuierten Spitznamen,
Dietze Föößje, und hinter em N´össje, einem früheren Mayener Schüler, verbirgt sich ein ehemaliger
Fußballspieler und Trainer von Bayern München, BVB, Bayer 04, Mainz 05 und anderen Vereinen.
Natürlich lassen sich auch Männernamen oder Spitznamen, die auf –i enden, als Verkleinerung ansehen: de
Jogi, de Bubi, de Chrissi etc.
Echtes Platt ist immer weniger zu hören und in der alltäglichen Kommunikation, Einkauf, Arzt, Behörde, wird heute Umgangssprache (Regiolekt) verwendet und längst nicht mehr jeder Noch-Platt-Sprecher beherrscht sicher dessen Regeln. Dadurch kommt es einerseits vermehrt zu Unsicherheit im „richtigen Gebrauch“ des Platts. Die Folge ist die gemischte Verwendung von Artikel und Pronomen: et und ihr statt et und säin. Vor 50 Jahren war das noch absolut undenkbar. Die Zuordnung war nicht nur im Platt, sondern auch in der Umgangssprache fest: Es hieß im Platt nur et Heike ón säine Hónd (wörtl. ‘seinen Hund‘). Dies wurde selbstverständlich so in die Umgangssprache hineingenommen: et Heike un seine Hund. Heutzutage ist umgangssprachlich durch die Interferenzen aus der Standardsprache et Heike und ihr Hund anzutreffen. Ganz verschwunden ist der alte Gebrauch aber noch nicht. Bei Mayenern, die noch häufiger Platt sprechen, ist die Zuordnung noch stabil: em Roswitha säin Freundin. Bei denen, die nur Umgangssprache verwenden, sind ‘es‘ und ‘sein‘ so gut wie verschwunden, z. B. die Trixi und ihr Haus. Ebenfalls, um sich der Standardsprache anzunähern, hat sich der Mayener umgangssprachlich den Gebrauch der hochdeutschen Artikel statt der dialektalen schwachen angeeignet. So weicht ehemaliges De Oma kommt. standardnäherem Die Oma kommt. Dasselbe gilt für de Oba / der Opa, de Jürgen / der Jürgen, et Gaby /die Gaby et Hannah / die Hannah.
Auch bei den Pluralformen der Personalpronomen werden die Varianten in Abhängigkeit von der gewünschten Betonung gebraucht: Die vollbetonte Form bedeutet einfach stärkere Hervorhebung. Bei der 1. Pers. Pl. Nom. heißt es für das standardsprachliche ‘wir‘mir oder ma. Der Gebrauch weicht nicht von dem der Standardsprache ab, z. B. Jimmir wäile? ‘Gehen wir jetzt?‘ oder Jimma wäile? ‘Gehen wir jetzt?‘, Mir /Ma säin mööd. ‘Wir sind müde.‘ und z. B. Fahre mir /ma wäile haam? ‘Fahren wir jetzt heim?‘. Im Dativ und im Akkusativ heißt es us: Dat Haus jehüürt us. ‘Das Haus gehört uns.‘ und Ma sehn us morje. ‘Wir sehen uns morgen.‘
Die 2. Pers. Pl. hat heute als volle Form nur mehr ihr. Vor etwa 50 Jahren wurde dafür auch dihr noch gebraucht: Dihr Kénnerscher, jihd ewäile haam! ‘Ihr Kinderchen, geht jetzt heim!‘ „Wößt ech, dat dir mir noh dät flaie“ ‘Wüsste ich, dass ihr mir nachsprächet; wörtl.: wüsste ich, dass mir nach tätet fleien.‘ Es war auch die höfliche Anrede: Dihr seht heut awa jaa nét goot aus! Jahdet Eusch nét goot? ‘Ihr seht heute aber gar nicht gut aus! Geht es Euch nicht gut?‘ Der Gebrauch der 2. Pers. Pl. als Höflichkeitsform, wie es im Englischen und im Französischen heute noch mit „You“ und „Vous“ der Fall ist, dürfte kaum noch bekannt sein – vom Gebrauch ganz zu schweigen. Heute kommt die 2. Pers. Pl. wohl ausschließlich als ‘ihr‘, und zwar nur in der „normalen“ Verwendung vor: Jihd ihr wäile? ‘Geht ihr jetzt?‘ Die schwache, reduzierte Form heißt a: Jihda wäile? ‘Geht ihr jetzt?‘. Wann kummt ihr daa? ‘Wann kommt ihr denn?‘ ‘ Wann kummdada? ‘Wann kommt ihr denn?‘ Die Dativform heißt eusch ‘euch‘: Bemm és daa der kruuse Jaade? Eusch? ‘Wem gehört denn der große Garten? Euch?‘ In der nicht mehr gebräuchlichen höflichen Anrede hätte es: Ésch jinn e St´öggelsche mét Eusch. ‘Ich gehe ein Stückelchen mit Euch.‘ geheißen. Der Akkusativ lautet auch eusch: Sehma eusch de Sunndaach? ‘Sehen wir euch am (wörtl.: den) Sonntag?‘
Die volle Form sie und auch die lautlich reduzierte se sind wie in der Standardsprache die Höflichkeitsform,
und zwar in allen Kasus: Bat w´öllen Sie / Se daa? ‘Was wollen Sie denn?‘ És der Jubbe vón Inne? ‘Gehört die
Jacke Ihnen; wörtl.: Ist der Juppen von Ihnen?‘ und Ésch hann Sie / Se jesder jesehn. ‘Ich habe Sie gestern
gesehen.‘ Für das standardsprachliche ‘sie‘ der 3. Pers. Pl. Nominativ gab (gibt?) es laut Literatur auch
die betonte Form säi für mehrere Personen: „Wenn sei nau ‚met‘ aas kumme sein“ ‘Wenn sie nun zur
Erstkommunion gegangen sind; wörtl.: Wenn sie nun mit eins (=jetzt) (ge)kommen sein (= sind)‘ (Autor nicht
feststellbar). Heute ist wohl nur noch die schwache Form se: Jinn se wäile? ‘Gehen sie jetzt?‘ im Gebrauch.
Für Betonung und Nachdruck wird se durch dee ‘die‘, den bestimmten Artikel für den Plural, ersetzt: Jinn
dee ewäile? ‘Gehen die jetzt?‘.
Für den Dativ heißt es inne ‘ihnen‘ z. B. Dat Audo és inne. ‘Das Auto gehört (wörtl.: ist) ihnen.‘ Daneben
wird der bestimmte Artikel gebraucht: denne ‘den‘: Dat Audo és denne. ‘Das Auto gehört denen.‘ Auch der
possessive Dativ wird gern gebraucht: Dat és denne ihr Audo. Wörtlich: ‘Das ist denen ihr Auto.‘ Im
Akkusativ heißt es wie im Nominativ se bzw. dee z. B. Ma sehn se / dee morje. ‘Wir sehen / sie die morgen.‘
Wann hasde se /dee daa jetróff? ‘Wann hast du sie / die denn getroffen?‘
- Die Aussprachevariante éj, durch die Liaison bedingt, unbetont, ohne Nachdruck, kann ebensowenig wie z. B. méjóch ‘mich auch‘, déjóch ‘dich auch‘, eujóch ‘euch auch‘ allein stehen. Vgl. hierzu auch Kapitel 4. ↩
- Weitere Beispiele: Wòhr, dau kümms doch óch? ‘Nicht wahr, du kommst doch auch?‘ und De prauchs ma jaa neust ze verzélle! ‘Du brauchst mir gar nichts zu erzählen.‘, Denn hasde nét gefròòcht. ‘Ihn (wörtl. den) hast du nicht gefragt‘. ↩
- Weitere Beispiele: Dat és nét dir! ‘Das gehört (wörtl.: ist) nicht dir.‘ und Dau/De kanns et da hólle kumme. ‘Du kannst es dir holen kommen‘. ↩
- Weitere Beispiele: Ésch sehn désch nét. ‘Ich sehe dich nicht‘. Und: Ma hann déjóm Maat jesehn. ‘Wir haben dich auf dem Markt gesehen.‘ ↩
- STENZ 1998 67, 68, 80. ↩
- KAIFER 1978, 370. ↩
- Aus „ROND ÜM DE MAARTBUR“ (Autor nicht feststellbar) in: GEIERMANN 1978, 368. ↩
- Vgl. RHEIN. 3, 1073. ↩
- *En és dahaam ist nicht möglich. ↩
- STENZ 1998, 49. ↩
- STENZ 1998, 49. ↩
- Zur demonstrativen Bedeutung der vollen Form des Artikels vgl. auch die Ausführungen zum Personalpronomen ‘es‘ in diesem Kapitel. ↩
- Ebenso wie im Englischen kann hie nicht für Sachen gebraucht werden. Auch deer, englisch ‘Hirsch‘, Mayener Platt ‘Tier‘, deef, englisch deep ‘tief‘ und it, starke Form für ‘es‘, englisch ‘es‘ zeigen die Verwandtschaft zum Englischen. ↩
- Vgl. hierzu auch Kapitel 9 zum Wem-Fall /Possessiven Dativ. ↩
- Zum Gebrauch von en im Nominativ siehe oben in diesem Kapitel. ↩
- Vgl. hierzu aber auch in diesem Kapitel die Ausführungen zu et. ↩
- In einigen hessischen Dialekten entspricht dem Mayener hie für den Hausherrn ein he, dem Mayener säi für Hausherrin hes. Der Mann bezieht sich auf seine Frau gern mit dieFrau: Die Frau hat das gesagt. ↩
- Es soll ausdrücklich erwähnt werden, dass im normalen Gebrauch weder die noch der mit Bezug auf Personen in irgendeiner Form abwertend gemeint sind. Möglich ist dies allein durch verächtliche Betonung, wie das in der Standardsprache genauso ist. ↩
- Vgl. hierzu Kapitel 4 die Ausführungen zu Liaison und Sandhi. ↩
- Siehe hierzu auch Kapitel 5 zu nehmen. ↩
- Also genau anders herum wie bei ‘er‘ und ‘sie‘, wo gern der Artikel gebraucht wird. ↩
- An dem Akkusativ-Beispiel ‘Fenster‘ lässt sich demonstrieren, wie sich e, et und dat in der Verwendung voneinander unterscheiden: Gibt es z. B. nur ein Fenster in einem Raum und es soll geschlossen werden, heißt es ohne Nachdruck einfach: Maach (doch jeraat) et Fisder zoo! ‘Mach (doch gerade mal) das Fenster zu (sei so nett); wörtl. mach doch gerade es Fenster zu!‘ (Es ist nur eins offen.) Soll ein bestimmtes von mehreren Fenstern geschlossen werden, heißt es in Verbindung mit einer Geste: Maach dat Fisder zoo! ‘Mach jenes Fenster zu!‘ (‘Jenes‘ kennt das Mayener Platt nicht.) Et und dat sind nicht gleichbedeutend und nicht beliebig wählbar. Will man einfach nur, dass irgendeins von mehreren Fenstern im Raum geschlossen wird, heißt es, wie standardsprachlich: Maach e Fisder zoo! ‘Mach ein Fenster zu!‘ ↩
- Im Folgenden wird nicht (jedesmal) zwischen Pronomen und Artikel unterschieden. Verschiedene hessische Dialekte haben ‘s, z. B. das Carmen, das Gertrud - ein Gebrauch, der stark zurückgeht ↩
- Tiere mit sächlichem Artikel, das Schwein, das Pferd etc. seien eingeschlossen. ↩
- Auf den seltenen Gebrauch von et bei älteren Jungen und Männern wird weiter unten eingegangen. ↩
- Zum Artikel vgl. hierzu Kapitel 16. ↩
- Das gilt auch für das Kölsche (ripuarisch): Hier isét Elfriede! Am ehesten: ‘Hier ist Elfriede!‘ ↩
- Für z. B. verschiedene hessische Dialekte, die nur das und kein et haben, mag das evtl. zutreffend sein, aber eben nicht für Mayen. ↩
- Als Personalpronomen verhält sich et grammatisch wie das standardsprachliche ‘es‘. ↩
- „es, et vertritt den Nom. u. Acc. des sächl. Artikels in unbetonter Stellung, während das, dat, dət als Artikel immer, wenn auch nur schwache demonstr. Nebenbed. hat“. RHEIN. 2, 177f. ↩
- Vgl. hierzu auch Kapitel 9 Possessiver Dativ. ↩
- AdA = ELSPAß & MÖLLER 2003ff. ↩
- „Wie das Akkusativ-Singular-Pronomen ihns in der Schweiz, so hat auch das Luxemburgische mit hatt eine Sonderform für die pronominale Wiederaufnahme weiblicher Rufnamen ausgebildet; dies spricht für ein hohes Alter dieses Systems […]. Diachron stammt hatt < ahd.-mfrk. *hit, bestehend aus dem Pronominalstamm germ. *hi- und dem neutralen Personalpronomen der 3SG germ. *it […]. Heute ist es ein grammatisch neutrales Pronomen mit exklusivem Bezug auf weibliche Rufnamen.“ NÜBLING u. a. 2013, 166. Dass dasselbe für den Artikel gilt, kann nur vermutet werden. Vgl. auch die Karten in Kapitel 1 und zu das/dat das Kapitel 3. ↩
- „Bis heute ist weder geklärt, wie das im Deutschen und anderen indogermanischen Sprachen übliche nominale Klassifikationsystem überhaupt entstanden ist, noch wie die einzelnen Nomen zu ihrem ganz bestimmten, in der Regel invarianten Genus gekommen sind.“ CHRISTEN 1998, 2 „Doch kann die Herkunft des onymischen Neutrums nicht als geklärt gelten.“ NÜBLING u. a. 2013, 167. ↩
- „Die Entstehung neutraler Namen wird von den Grammatiken auf die häufige Diminution weiblicher Rufnamen zurückgeführt, was anschließend dazu geführt haben soll, dass auch nichtdiminuierte Namen als Neutra reanalysiert wurden.“ NÜBLING u. a. 2013, 161. ↩
- Jemand sagt empört zu einem Mann: Wie kannst du nur et Gaby sagen?! (Dabei benutzen Frauen und Männer gleichermaßen et, weil es sonst nichts gibt). Z. T. wird in der Sprachwissenschaft angenommen, der Gebrauch von et für Frauen sei durch Männer vorsätzlich zur Herabsetzung dieser eingeführt worden. ↩
- Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass es Männer sind, die „wählen“. „Dabei gilt als sicher, dass es kein Zufall ist, dass das „Genus für Kindliches und vor allem Nicht-Belebtes, also Nicht-Agentives, gewählt wird“. NÜBLING u. a. 2013, 192. ↩
- „Mensch“ in: DWDS https://www.dwds.de/wb/etymwb/Mensch. ↩
- „Frau“ in: DWDS https://www.dwds.de/wb/etymwb/Frau. ↩
- „Weib“ in: DWDS https://www.dwds.de/wb/etymwb/Weib. ↩
- „FRAUENMENSCH, vormals, gleich dem einfachen mensch, gültige und edle benennung einer frau, z. b. pers. baumg. 2, 15. nnl. vrouwmensch.“ Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm https://www.woerterbuchnetz.de/DWB. ↩
- Zu ‘Fräulein‘ siehe weiter unten in diesem Kapitel. ↩
- NÜBLING u. a. 2013, 172. ↩
- Siehe hierzu Veränderungen im Mayener Platt in diesem Kapitel. ↩
- Vgl. hierzu in diesem Kapitel zum Personalpronomen ‘sie‘. ↩
- In der Linguistik wird dies schon mal anders gesehen: In dem ripuarischen Beispiel „Ming Cousin Maria kütt morje zo Besoch. Et wunt in Kölle. ‘Meine Cousine Maria kommt morgen zu Besuch. Es wohnt in Köln.’“ (NÜBLING u. a. 2013, 176) bezieht sich ming auf die Kusine, also feminin, und et ‘es‘ auf Maria. Es ist ein Beispiel dafür, dass man n i c h t wählen kann. ↩
- Es ist für Mayen schlicht falsch, dass „Unverheiratete [.] eher neutral klassifiziert [werden] (ganz analog zu dem bis vor kurzem oder dialektal heute noch existierenden Neutrum Fräulein), Verheiratete dagegen feminin (vgl. Frau)“. Und die Aussage, „[d]ass hinter alledem eine männliche Perspektive steht, wird noch thematisiert, doch tritt diese besonders deutlich durch das ebenfalls vorgefundene Kriterium des Familienstands der betreffenden Frau zutage“ (NÜBLING u. a. 2013, 189), ist nicht haltbar. ↩
- „Frau“, DWDS https://www.dwds.de/wb/etymwb/Frau. ↩
- Die in der sprachwissenschaftlichen Literatur wegen ihres Status als „angesehen“ bezeichnete verheiratete Frau war noch in den 50er, 60er, 70er Jahren meist Hausfrau, die heute eher ein geringes soziales Ansehen hat, und im Gegensatz zum Fräulein keineswegs selbständig, sondern finanziell und rechtlich vom Ehemann abhängig. Dagegen war das Fräulein finanziell unabhängig, hat seinen Lebensunterhalt selbst verdient und war deshalb stolz auf seinen Titel (mhd. vrouwelīn ‘Herrin, Gebieterin, junge unverheiratete Edeldame’), der heute als herabsetzend empfunden wird. ↩
- Fräulein Agnes Schäfer war eine Klassenkameradin des Vaters der Autorin. ↩
- „Feminines Namengenus drückt dagegen eher soziale Distanz und Respekt aus. Damit wird Genus bei Namen wählbar“. (NÜBLING u. a. 2013, 154) Für das Mayener Platt trifft beides nicht zu. Bei de Uroma, de Oma, de Mamma, de Tant sind ebenso wenig wie bei Schwester, Schwägerin etc. Distanz und Respekt im obigen Sinn ersichtlich. ↩
- Kneipenbesitzer óf da Stehwésch, der der Autorin aber nur aus Erzählungen bekannt ist. ↩
- Vgl. hierzu Die Autorin weiß aus eigener Erfahrung, dass das vor 50 Jahren anders war. ↩
- Vgl. hierzu auch den Gebrauch der betonten Formen (Sg. u. Pl.) des Artikels der, dee, dat in Kapitel 16. ↩
- Aus „Wößt ech, dat dir mir noh dät flaie“(Lied?); Autor nicht feststellbar; in: GEIERMANN 1978, 376 ↩
- Vgl. hierzu in diesem Kapitel Personalpronomen 3. Pers. Sg. fem. und 3. Pers. Pl. ↩
- GEIERMANN 1978, 373. ↩
- Vgl. hierzu auch den Gebrauch der vollen Formen (Sg. u. Pl.) des Artikels der, dee, dat in Kapitel 16 und RHEIN. 8, 124. ↩
12. Possessivpronomen
mäin, däin, säin; mäi Vadder, mäi Módder, mäi Prooder Von den Possessivpronomen / besitzanzeigenden Fürwörtern
Dat és mäine Teller ‘mein Teller‘, däin Tösch ‘deine Tasche‘, säi Audo ‘sein Auto‘ - das Possessivpronomen, das besitzanzeigende Fürwort, gibt, wie der Name sagt, an, (zu) wem etwas gehört. Das gilt auch für Personen: mäine Onggel ‘mein Onkel‘, mäin Doochder ‘meine Tochter‘, mäi Kénd ‘mein Kind‘. Die folgende Tabelle gibt die Formen des Possessivpronomens in attributiver Stellung wieder:
| 1. SINGULAR | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | mäine Onggel | mäin Doochder | mäi Kénd |
| Dat. | mäinem Onggel | mäiner Doochder | mäinem Kénd |
| 2. SINGULAR | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | däine Onggel | däin Doochder | däi Kénd |
| Dat. | däinem Onggel | däiner Doochder | däinem Kénd |
| 3. SINGULAR | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | säine Onggel | säin Doochder | säi Kénd |
| Dat. | säinem Onggell | säiner Doochder | säinem Kénd |
| 1. PLURAL | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | oose Onggel | oos Doochder | oos Kénd |
| Dat. | oosem Onggel | ooser Doochder | oosem Kénd |
| 2. PLURAL | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | eure Onggel | euer Doochder | euer Kénd |
| Dat. | eu(e)rem Onggel | eurer Doochder | eurem Kénd |
| 3. PLURAL | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | ihre Onggel | ihr Doochder | ihr Kénd |
| Dat. | ihrem Onggel | ihrer Doochder | ihrem Kénd |
Die Beugung des attributiv gebrauchten besitzanzeigenden Fürworts wird durch das grammatische Geschlecht
(der, die, das), Singular und Plural und durch den Kasus (Fall) bestimmt.
Beispiele für das besitzanzeigende sächliche Fürwort sind: Nominativ / Wer-Fall: Dat és säi Jelass. ‘Das
ist sein Glas.‘, Dativ / Wem-Fall: Schnäid mét däinem Messer. ‘Schneide mit deinem Messer.‘, Akkusativ /
Wen-Fall: E praucht säi Audo. ‘Er braucht sein Auto.‘ Im Plural (Mehrzahl): Dat és oos Haus. ‘Das ist unser
Haus.‘ (Nominativ), Der wónnt én oosem Haus. ‘Er (wörtl.: der) wohnt in unserem Haus.‘ (Dativ). Ma hóllen
oos Audo. ‘Wir holen unser Auto (ab) und: Wir nehmen /benutzen unser Auto.‘ (Akkusativ). Und auch bei et
‘es‘ in Verbindung mit dem Vornamen: Dat és oos Hannah. ‘wörtl.: Das ist unser Hannah.‘ (Nominativ), E
jéddet oosem Hannah. ‘Er gibt es unserem Hannah.‘ (Dativ) Säihsde oos Hannah? ‘wörtl.: Siehst du unser
Hannah?‘ (Akkusativ).
Beim Maskulinum (männlichen Geschlecht) wird im Mayener Platt nicht zwischen der Form für den Nominativ und
der für den Akkusativ unterschieden. Diese fallen zu der Form für den Akkusativ zusammen: Auch im Nominativ
heißt es mäine Onggel ‘meinen Onkel‘ statt ‘mein Onkel‘, däine Onggel ‘deinen Onkel‘ statt ‘dein Onkel‘,
(säine ‘seinen‘ statt ‘sein‘ oose ‘unseren‘ statt ‘unser‘, eure ‘euren‘ statt ‘euer‘, ihre Onggel ‘ihren‘
statt ‘ihr Onkel‘). Das -n von ‘meinen‘ usw. fällt dabei weg. Im Mayener Platt heißt es: Dat és mäine
Onggel. ‘Das ist mein Onkel.‘ (Nominativ) und Ésch sehn mäine Onggel. ‘Ich sehe meinen Onkel.‘ (Akkusativ).
Für den Dativ für die 2. Pers. Pl. heißt es beispielsweise: Dee wónnen ém Haus vón eurem Onggel Peder.
‘Sie (wörtl.: die) wohnen im Haus von eurem Onkel Peter.‘
Auch im Femininum fallen im Nominativ und Akkusativ die Endungen weg: mäin Doochder, däin Doochder etc.
‘meine Tochter usw.‘ Für die 1. Pers. Sg. heißt es: Dat és mäin Doochder. ‘Das ist meine Tochter.‘
(Nominativ), für die 2. Pers. Pl. heißt es: Dat schenggen ésch eurer Doochder. ‘Das schenke ich eurer
Tochter.‘ (Dativ) und für die 3. Pers, Pl. heißt es: Kennda ihr Doochder? ‘Kennt ihr ihre Tochter?‘
(Akkusativ). (Bei allen drei Geschlechtern sind die Formen der 1. Pers. Pl. stärker von der Standardsprache
abweichend.)
Einige Verwandtschaftsbezeichnungen fallen aus dem oben dargestellten Schema heraus. Sie bilden eine kleine, sehr alte Klasse von Substantiven (Hauptwörtern) mit eigenen Formen der Possessivpronomen. In diese gehören m. W. ausschließlich Vadder, Módder, Prooder, Schwòòrer und deren Zusammensetzungen wie (Ur-)Krußvadder, ‘(Ur-)Großvater‘, Schwiejervadder ‘Schwiegervater‘, (Ur-)Krußmódder ‘(Ur-)Großmutter‘, Schwiejermódder ‘Schwiegermutter‘ (Steefprooder ‘Stiefbruder‘?). Im Einzelnen sind die Formen:
| 1. SINGULAR | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | mäi Vadder | mäi Módder | mäi Kénd |
| Dat. | mäinem Vadder | mäiner Módder | mäinem Kénd |
| 2. SINGULAR | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | däi Vadder | däi Módder | däi Kénd |
| Dat. | däinem Vadder | däiner Módder | däinem Kénd |
| 3. SINGULAR | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | säi Vadder | säi Módder | säi Kénd |
| Dat. | säinem Vadder | säiner Módder | säinem Kénd |
| 1. PLURAL | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | oos Vadder | oos Módder | oos Kénd |
| Dat. | oosem Vadder | ooser Módder | oosem Kénd |
| 2. PLURAL | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | euer Vadder | euer Módder | euer Kénd |
| Dat. | eu(e)rem Vadder | eurer Módder | eurem Kénd |
| 3. PLURAL | MASKULINUM | FEMININUM | NEUTRUM |
|---|---|---|---|
| Nom./Akk. | ihr Vadder | ihr Módder | ihr Kénd |
| Dat. | ihrem Vadder | ihrer Módder | ihrem Kénd |
Darüber, ob ‘Kind‘ in diese Klasse oder in die „allgemeine“ gehört, lässt sich nichts sagen, da die Formen in beiden Klassen gleich wären.
In dieser alten Klasse, Kind sei hier eingeschlossen, sind im Nominativ und Akkusativ die Formen für alle drei Geschlechter gleich: mäi ‘mein‘, also: ‘mein Vater‘, ‘mein Mutter‘, ‘mein Kind.‘ Die alte männliche Form stimmt mit der Standardsprache überein. Ein Beispiel hierzu für den Plural, also ‘unser‘, ist: „Ohs Vadda söt ümma,‘dir dräi säid net pur.‘“ ‘Unser Vater sagt immer, ‚ihr (wörtl.: dihr) drei seid nicht recht gescheit.‘ (Nominativ). Im Nominativ und Akkusativ Plural traten zumindest früher diese endungslosen Formen auch bei männlichen Vornamen auf. Im ältesten Platt hieß es oos Nick und nicht oose Nick, wie es bei der „regulären“ Flexion zu erwarten wäre. Bei den Possessivpronomen für die 1. – 3. Pers. Sg. maskulinum dieser Kleinklasse ist die Zuordnung heute wohl nicht mehr strikt, sondern wird freier gehandhabt, und sowohl oos, euer, ihr als auch oose, euere, ihre Vadder / Proder kommen vor.
Die endungslose Form des Pronomens gilt für die Substantive dieser Klasse auch beim possessiven Dativ nach
dem Demonstrativpronomen ‘dem‘ oder dem Fragepronomen ‘wem‘: Demm säi Vadder, Módder, Prooder oder Bemm säi
Vadder, Módder, Prooder?, aber: Bemm säine Onggel und bemm säin Schwester, Doochder?
Tritt zum Possessivpronomen ein Adjektiv, so wird auch bei Vadder, Módder, Proder „regulär“ flektiert:
mäine aale Vadder, mäine äldere Prooder, mäin aal Módder.
Wie beim Possessivpronomen steuert die alte substantivische Kleinklasse auch die Flexion des
Indefinitpronomens kein bei Vadder und Módder: kaa Vadder, kaa Módder. Bei den Zusammensetzungen, Großvater
etc., sowie bei Bruder, Stiefbruder und Schwager ist dies nicht der Fall.
Wie in der Standardsprache wird die Beugung nicht nur von Singular oder Plural des Pronomens (z. B. mein, unser) gesteuert, sondern beim Maskulinum auch von Singular und Plural des zugehörigen Substantivs. Je nachdem, ob das Substantiv im Singular oder Plural steht, nimmt auch das Possessivpronomen unterschiedliche Formen an: Es heißt in Nominativ und Akkusativ oose Onggel/oose Soh²n ‚‘unser Onkel / unser Sohn‘ (wörtl.: unseren Onkel/ unseren Sohn), im Plural aber oos Onggele /oos Sö1hn ‘unsere Onkel, unsere Söhne‘ (wörtl.: unser Onkel(en)/ unser Söhne). Genauso stehen sich im Dativ oosem So²hn (‘unserem Sohn‘) und oose Sö1hn (‘unseren Söhnen‘) gegenüber: Dat és das Haus vón oosem So²hn und Dat és dat Haus vón oose Sö1hn. Die entsprechenden Formengegensätze für die 2. Pers. lauten im Nominativ und Akkusativ eure So²hn - euer Sö1hn, im Dativ eurem So²hn - eure Sö1hn und für die 3. Pers. im Nominativ und Akkusativ ihre So²hn – ihr Sö1hn sowie im Dativ ihrem So²hn – ihre Sö1hn.
Eine andere Art des Gebrauchs des Fürworts ist: Der Teller és mäin ‘Der Teller ist mein‘, Dee Tösch és däin
‘Die Tasche ist dein‘, Dat Audo és säin ‘Das Auto ist sein‘.
Bei diesem prädikativen Gebrauch gibt es im Mayener Platt drei Möglichkeiten, Besitzverhältnisse
auszudrücken. Sie werden zunächst für das Neutrum vorgestellt, wo es die deutlichsten Formunterschiede zur
Standardsprache gibt:
1. Dat Haus és mäi²n. ‘Das Haus ist mein‘.
2. Dat Haus és mir. ‘Das Haus ist mir.‘
3. Dat Haus és mäi²nt /mäi²nde ‘Das Haus ist meins /meines‘.
Der dritte Typ (wahrscheinlich ein Genitivrest) unterscheidet sich beim Femininum nur durch den
Tonakzentwechsel vom ersten:
1. Dee Garaasch és mäi²n. ‘Die Garage ist mein‘.
2. Dee Garaasch és mir. ‘Die Garage ist mir.‘
3. Dee Garaasch és mäi1n. ‘Die Garage ist meine, die meinige‘.
Die vollständigen Formen für die verschiedenen grammatischen Geschlechter lauten:
Der Jaade és mäi²n (däi²n, säi²n, i²hr, us /oo1ser, eusch, inne). ‘Der Garten ist mein.‘
Der Jaade és mir (dir, imm, ihr, us, eusch, inne). ‘Der Garten ist mir.‘
Der Jaade és mäi1ne (däi1ne, säi1ne, ih1re, oo1se, eu1re, i1hre). ‘Der Garten ist meiner‘.
Dee Garaasch és mäi²n. ‘Die Garage ist mein‘.
Dee Garaasch és mir. ‘Die Garage ist mir.‘
Dee Garaasch és mäi1n (däi1n, säi1n), i1hr, oo1s, eu1er, i1hr.) ‘Die Garage ist meine, die meinige‘.
Dat Haus és mäi²n. ‘Das Haus ist mein‘.
Dat Haus és mir. ‘Das Haus ist mir.‘
Dat Haus és mäi²nt /mäi²nde (däi²nt / däi²nde, säi²nt /säi²nde, i²hrt /i²hrde, oo²st / oo²sde, eu²ert /
eu²erde, i²hrt / i²hrde). ‘Das Haus ist meins / meindes (=meines).‘ [deins / deindes etc., unsers/
unserdes, euers / euerdes, ihrs / ihrdes‘].
Beim Plural gibt es keine unterschiedlichen Formen für die verschiedenen grammatischen Geschlechter:
Dee Bööjer säi²n mäi²n (däi²n, säi²n, i²hr, us, eu²sch, inne). ‘Die Bücher sind mein.‘
Dee Bööjer säi²n mir. ‘Die Bücher sind mir.‘
Dee Bööjer säi²n mäi1n (däi1n, säi1n, i1hr, oo1s, eu1er, i1hr). ‘Die Bücher sind meine‘.
Auch „Possessive Ausdrücke“ können anstatt Nomen gebraucht werden:
Nom.: Dat és mäine ‘meiner‘ (z. B. Pullover).
Dat és mäin ‘meine‘ (z. B. Jacke).
Dat és mäint, mäinde ‘meins‘ (z. B. Handtuch).
Plural: Dat säin mäin ‘meine‘ (z. B. Bücher).
Akk.: Dau kanns mäine hann ‘meinen‘ (z. B. Pullover).
Dau kanns mäin hann ‘meine‘ (z. B. Jacke).
Dau kanns mäint, mäinde hann ‘meins / „meindes“ (z. B. Handtuch).
Plural: Dau kanns mäin hann ‘meine‘ (z. B. Bücher).
- Vgl. hierzu auch Kapitel 11 Personalpronomen ‘er‘. ↩
- Vgl. hierzu die Ausführungen Kapitel 4 zu Apokope. So scheinen maskuline und feminine Formen vertauscht: *meine Vater, *mein Mutter (oder Kölsch: minge Vadder, ming Módder). ↩
- RITTEL 1998, 55. ↩
- Ob diese Form heute noch gebraucht wird, ist nicht bekannt. ↩
- Vgl. Kapitel 9 zum possessiven Dativ. ↩
- Auch bei verschiedenen anderen Substantiven kann beim Indefinitpronomen kein zwischen kaa und kaan bzw. kaa und kaane gewählt werden, also entweder ohne schließendes –n bzw. -ne oder mit: feminin z. B. kaa/ kaan Bódder ‘Butter‘, kaa/ kaan Wurscht ‘Wurst‘, kaa/ kaan Zäit, kaa / kaan Art ‘keine Lust‘und maskulin kaa /kaane Kawwie ‘keinen Kaffee‘, kaa /kaane Käs ‘keinen Käse‘, kaa /kaane Koore ‘keinen Kuchen‘. Es heißt auch entgegen den Regeln: aa Kopp ón aa Aasch ‘ein Herz und eine Seele.‘ ↩
- RHEIN. 9, 58 „der Garde es os u. osər; dat Hus es os u. osət“; vgl. auch GRAMMATIK-DUDEN 324, §547 Endungsloser Gebrauch. ↩
- Mäi²nt etc. haben ebenso wie dat, wat et das t nicht verschoben. Mäinde etc. sind evtl. durch Abfall von t bei mäindet (=‘meindes‘) etc. entstanden. Auch in der Standardsprache ist noch das t unverschoben in meinetwegen, deinetwegen etc. und meinethalben etc., seinetwillen erhalten geblieben. ↩
- Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Possessivpronomen ↩
13. Ésch hanner noch
E és es mööd! Ésch hannes noch! Hasderar noch? Eine besondere possessive Konstruktion
Eine possessive Konstruktion, die auch die Standardsprache so kennt und die am besten mit ‘dessen‘
wiederzugeben ist, ist: E és əs mööd. ‘Er ist dessen müde /ist es (wörtl. dessen) leid‘; E és əs laad ‘Er
ist es (wörtl. dessen) leid / hat es satt‘; Se és əs satt ‘Sie ist es (wörtl. dessen) leid / hat es satt‘.
Je nachdem, ist außer ‘dessen‘ auch ‘davon‘ als „Übersetzung“ möglich: Ésch hann əs jenooch ‘Ich habe davon
/dessen genug; etwa: ‘Ich habe davon die Nase voll‘. Diesen sogenannten Genitivus partitivus, der sich auf
etwas vorher Erwähntes, eine zuvor erwähnte Sache bezieht, gibt es im Mayener Platt nicht nur in
feststehenden Ausdrücken, wo er in der Form ‘es‘ [əs] vorkommt.
Eine Besonderheit des Mayener Platts, die es mit anderen moselfränkischen und ripuarischen Dialekten und
dem Niederländischen teilt, aber ist, dass „der Genit. partit. u. object. [.] noch lebendig [ist]“
(RHEIN. 1, 1323), d. h., er kommt außer in den feststehenden Ausdrücken auch noch im normalen
Sprachgebrauch vor. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine dem Mayener wohlbekannte und im Platt sowie in
der Umgangssprache alltäglich rege gebrauchte Konstruktion, die außer als əs [əs] ‘des, dessen‘ auch als er
[ɑ] vorkommt. Dabei erscheint əs immer einfach nur als əs und darf nicht mit dem Mayener Personalpronomen
‘es‘ et [ət] verwechselt werden. „Er“ [ɑ] dagegen hat verschiedene Realisierungen, und zwar er [ɑ], era
[əʁɑ], ara [ɑʁɑ], die willkürlich eingesetzt werden. Er [ɑ] und əs [əs] sind immer unbetont und lehnen sich
stets an das vorhergehende betonte Wort an.
Er [ɑ] und əs [əs] sind Platzhalter für eine Sache, ein Stellvertreter für ein Substantiv. Man bezieht sich
mit diesem auf eine unbestimmte Anzahl oder Menge von etwas vorher Genanntem, z. B. in der Antwort auf die
Frage: Bévill Kénner hasde? Ésch hannara träi. Oder: Ésch hannes träi. ‘Wie viele (eigentl.: Wieviel)
Kinder hast du? Ich habe ihrer/derer drei. Oder: Ich habe dessen drei.‘ Standardsprachlich lässt sich əs
[əs], je nachdem, auch mit ‘dessen’ und ‘davon‘ sowie mit ‘welches‘ und er [ɑ] mit ‘ihrer‘, ‘derer‘ oder
‘welche‘ wiedergeben.
Ob er [ɑ] oder əs [əs] verwendet wird, hängt nur vom grammatischen Geschlecht des Substantivs ab.
Zählbarkeit (Kartoffeln, Schuhe, Bücher) oder Nichtzählbarkeit von Sachen (Milch, Kaffee, Salz) ist ohne
Bedeutung. Für das Mayener Platt gilt: əs [əs] geht immer, also bei jedem grammatischen Geschlecht.
Substantive mit maskulinem oder sächlichem Artikel haben aber ausschließlich əs, er [ɑ] ist hier nicht
möglich. Beispiele sind: Mir hann kaa Zugger mih. Mir möösen əs kauwe. ‘Wir haben keinen Zucker mehr. Wir
müssen welchen (wörtl. dessen) kaufen.‘ Se hann əs kaane. ‘Sie haben davon /dessen keinen; sie haben keinen
(Wein).‘ Has dau noch Kawwie? Ésch hann es noch. ‘Hast du noch Kaffee? Ich habe noch welchen /dessen
noch.‘ Has dau noch Méll? Ésch hann əs noch. ‘Hast du noch Mehl? Ich habe noch welches / dessen noch.‘ E
käuft kaant. E haddəs noch ‘Er kauft keins. Er hat davon /dessen noch; er hat noch welches (Fleisch).‘ Ma
hann əs kaant. Ma hóllen əs noch. ‘Wir haben dessen keins. Wir holen dessen noch; wir holen noch welches
(Bier).‘ Et Pruut wòr all. Se moosdenəs bagge.‘Das Brot war alle. Sie mussten welches (wörtl. dessen)
backen.‘
Dagegen haben Substantive mit weiblichem Geschlecht, sowohl Singularformen als auch Pluralformen, zusätzlich
er [ɑ]. In diesen Fällen kann nach Belieben zwischen əs [əs] und er [ɑ] gewählt werden:
Wéllsde Krómbere? Naa, ésch jinn_era jeraat kauwe. Oder: Ésch jinn əs jeraat kauwe. ‘Willst du Kartoffeln?
Nein, ich gehe ihrer/derer gerade kaufen. /Ich gehe gerade welche kaufen.‘Kannsde ma jet Bódder jénn? Ésch
hann_ ara kaan mih. Oder: Ésch hann_əs kaan mih. ‘Kannst du mir etwas Butter geben? Ich habe ihrer/derer
keine mehr.‘ Oder: Ich habe dessen keine mehr.‘ Wuascht prauren ésch nét – ésch hann_era noch jenoocht.
Oder: Ésch hann_ əs noch jenoocht. ‘Wurst brauche ich nicht – ich habe ihrer/derer noch genug. Oder: Ich
habe dessen noch genug.‘ Has de noch Zigaredde? Naa, ésch hann_er kaan mih. Oder: Naa, ésch hann_ əs kaan
mih. ‘Hast du noch Zigaretten? Nein, ich habe ihrer/derer keine mehr.‘ Wéllsde noch Abbelsiene métpraacht
hann? Jòò, ésch k´önnd_er noch praure. Oder: Jòò, ésch k´önnd_ əs noch praure. ‘Willst du noch Apfelsinen
mitgebracht haben? Ja, ich könnte ihrer/ derer noch gebrauchen. Oder: Ich könnte dessen noch gebrauchen.‘
Ésch hann era / əs noch. ‘Ich habe deren /dessen noch. Ich habe noch welche‘. Owe säin əs / a /era/ ara
noch. ‘Oben sind dessen /derer noch. Oben sind noch welche.‘ Jémmarəs! Gib mir dessen /welches! Jémmara!
Gib mir deren /welche! Auch bei Et jéddər ‘Es gibt ihrer /derer/ welche‘. Et wòrenər zehn. ‘Es waren ihrer/
derer zehn.‘ Ma haddarer su ón esuu. ‘Es gibt solche und solche (z. B. Leute); wörtl.: Man hat ihrer /derer
so und so.‘ ist auch jeweils əs möglich: Et jéddəs. Et wòòrenəs zehn. Ma haddəs su ón esuu.
- Im Niederländischen von BECH das „quantitative Pronomen _er“ genannt: vgl. BECH 2002, 26ff. ↩
- Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lsch_(Sprache „Kölsch Sprache“. Darüber hinaus erinnert er stark an das französische Adverbialpronomen en, z. B. J’en ai trois. ‘Ich habe drei davon. /Ich habe ihrer drei.‘ ↩
- Vgl. RHEIN. 2, 177. ↩
- Das Beispiel lässt erkennen das es sich hierbei keineswegs um das Personalpronomen es handelt, da dessen dialektale Form et lauten würde: Se moosden et bagge. ↩
- Vgl. hierzu z. B. RHEIN. 3, 1078. ↩
- Vgl. RHEIN. 8, 124. ↩
14. Demonstrativpronomen
Der, dee, dat. Häi der, lòh der. Demonstrativpronomen und die Adverbien ‘hier‘ und ‘da‘
Bee jefällt da daa mäine neue Rock? Der és schön. ‘Wie gefällt dir denn mein (wörtl.: meinen) neuer Rock?
Der ist schön.‘ Ésch wéll aas em Peder „Tach“ sòòn. Denn hann ésch én da K´ösch jesehn. ‘Ich will mal
Peter „Guten Tag“ sagen. Den habe ich in der Küche gesehen.‘ Dee Bócks kannsde nét én de Stadt andoon! ‘Die
Hose kannst du nicht in der Stadt tragen! Wörtl.: die Buckse kannst du nicht in die Stadt antun.‘ Dee Schoh
säin nét bequem. Én denne jinn ésch nét goot. ‘Die Schuhe sind nicht bequem. In denen gehe ich nicht gut.‘
Bemm és dat Booch? Dat és da Mamma. ‘Wem gehört das Buch? Das gehört Mama. Wörtl.: Das ist der Mama.‘: Die
Demonstrativpronomen der, die, das werden wie in der Standardsprache gebraucht und ebenso dekliniert.
Es gab im Mayener Platt auch das Demonstrativpronomen sell, das heute aber ausgestorben und auch praktisch
nicht mehr bekannt ist. Es ist aus ‘selb‘ entstanden und nicht, wie teilweise behauptet wird, aus dem
französischen celà ‘dies, das‘. Sell für ‘jener‘ kam (wohl) vor als seller ‘jener‘, sell(i) ‘jene‘ und
sell ‘jenes‘.
Die standardsprachlichen Ortsadverbien ‘hier‘ und ‘da‘ sind im Mayener Platt geläufig und werden mit oder
ohne deutende Gesten gebraucht, z. B. Häi /Dòò läit et doch! ‘Hier /Da liegt es doch! Tippt man sich aber
bei Dau bés jòò häi! (oder nur: Häi!) an die Stirn, ist die Bedeutung speziell: ‘Du hast sie ja nicht alle!
Wörtl.: Du bist ja hier!‘ Hingegen kommt ‘dort‘, abgesehen von z. B. der Redewendung: Der wòr frääsch bés
dort hinaus üwer mésch! ‘Er war extrem frech zu mir! Wörtl.: Der war frech bis dort hinaus über mich!‘, so
gut wie überhaupt nicht vor. Statt ‘dort‘ heißt es auch in dem Fall ‘da‘ dòò, z. B. Dòò éset! ‘Da ist es!‘
und eher noch häufiger (e)lòh. Auch (e)lòh hat nichts, wie gelegentlich angenommen wird, mit dem
französischen là ‘dort‘ zu tun, sondern ist die dialektale Variante von ‘all-da‘ (RHEIN. 1,107), z. B. Kuck
doch aas elòh! ‘Sieh doch mal dort (nach).‘ Lòh és en doch! Dort ist er doch!
Lòh kann aber nur gebraucht werden, wenn sich die betreffende Stelle, Sache, Person im Sichtbereich der
beteiligten Personen befindet. Ist dies nicht der Fall, ist ausschließlich dòò ‘da‘ möglich: Dòò kamma goot
ääse. ‘Da (in dem Restaurant) kann man gut essen.‘
Die standardsprachlichen Demonstrativpronomen ‘dieser, diese, dies(es)‘ kommen m. W. im Mayener Platt nur
in der Neutrumsverbindung dütt ón dat vor, z. B. E hat noch dütt ón dat verzéllt. ‘Er hat noch dies und das
erzählt. /Er hat noch allerlei erzählt.‘ „Dütt on datt of Mayener Platt“ hieß ehemals auch eine Rubrik in
der Mayener Rheinzeitung.
Anstelle von ‘dieser, diese, dies(es)‘ mit Bezug auf einen Ort wird mit oder ohne deutende Gesten das
Adverb ‘hier‘ zusammen mit dem Demonstrativpronomen gebraucht, also: ‘hier + der / die / das / Pl. die‘:
im Nominativ häi der, häi dee, häi dat, im Plural häi dee, im Dativ häi demm, häi der, häi demm, häi denne
und im Akkusativ häi denn, häi dee, häi dat, häi denne oder auch umgedreht der häi etc., z. B. Häi der /Der
häi és schöner. ‘Hier der / der hier ist schöner.‘ Statt ‘jener, jene, jenes‘, die dem Mayener Platt völlig
fremd sind, heißt es (e)lòh + Artikel, also ‘allda + der / die/ das‘. Im Nominativ heißt es lòh der, lòh
dee, lòh dat, im Plural lòh dee. Für den Dativ sind die Formen lòh demm, lòh der, lòh demm, lòh denne, für
den Akkusativ lòh denn, lòh dee, lòh dat, lòh denne, wobei i. d. R. mit dem Finger auf die Stelle oder die
Sache gedeutet wird, z. B. Lòh (hénne) dee jefalle ma nét esu goot! ‘Jene (wörtl. allda die) (hinten)
gefallen mir nicht so gut!‘ Es wird auch für Personen gebraucht: Der (e)lòh! ‘Jener; wörtl.: Der dort!‘
Sowohl ‘hier‘ als auch ‘allda‘ verbinden sich mit vielen anderen (Orts)adverbien: hieraußen: 1. jause: '
draußen im
Gegensatz zu drinnen, innerhalb eines Raumes'. - 2. häijause: 'draußen, wo sich auch der Sprechende
befindet'; hierüben: 1. jüüwe 'drüben auf der gegenüberliegenden Straßenseite'. - 2. häijüüwe 'die
Straßenseite, wo sich auch der Sprechende befindet (der Angesprochene ist auf der anderen Seite)'.
Hierinnen: 1. jénn: 'drinnen, innerhalb eines Raumes, Hauses im Gegensatz zu draußen'; (nicht identisch
mit: darin, in etwas befindlich; dafür: ‘drin‘ trénn). - 2. häijénn 'drinnen, wo sich auch der Sprechende
befindet'. Weitere Ortsadverbien sind: häitrénn ‘hierdrin‘; auch: häilangst ‘hierlangst (= hierentlang),
häieraus ‘hier heraus‘, häierénn ‘hier herein‘ häierümm ‘hier herum‘, häierüwer ‘hierherüber (= hier
entlang)‘ und auch lòherénn ‘alldaherein (= dorthinein), lòhtrann ‘alldadran (an etwas daran befindlich,
an etwas fest Dat és fest lòhtrann. Das ist (an dem Gegenstand) fest)‘, lòhbäi ‘alldabei (= bei etwas
anderem): Lòhbäi moosde goot ófpasse! ‘Dabei musst du gut aufpassen!), lòhtróf ‘alldadrauf (= auf etwas
anderem darauf), lòhtrénn ‘alldadrinnen (= in etwas drin befindlich; nicht Raum; beim Raum nur: jénn‘),
lòhjüwe ‘alldadrüben (= drüben) u.v.m.
In Verbindung mit Zeitbegriffen gibt es ‘hier‘ in der Wendung häi ón dòò ‘ab und zu, gelegentlich‘, etwa:
Ésch trénggen häi ón dòò mòòl e Jelässje Wäin. ‘Ich trinke ab und zu mal ein Gläschen Wein.‘ oder Se hann
en häi ón dòò aas jetróff. ‘Sie haben ihn gelegentlich getroffen.‘ Bei „Nichtkörpern“ kommt ‘dies‘ im
Mayener Platt vor, und zwar als düüs Dies betrifft direkte zeitliche Angaben, z. B. E kümmt düüs Wóch bäi
us. ‘Er kommt diese Woche zu (wörtl. bei) uns‘, Ma säin em düüs Daach noch bejäänt. ‘Wie sind ihm vor
kurzem / kürzlich /vor ein paar Tagen noch begegnet.‘, Düüse Mònat hadden neust verdeent. ‘Diesen Monat hat
er nichts verdient.‘, Düüs Naacht joong owaas de Sireen. ‘Heute Nacht gab es plötzlich (Feuer-)Alarm. Wörtl.
Diese Nacht ging auf einmal die Sirene.‘ und Ausdrücke wie düüsmòòl ‘diesmal‘, düüsjòhr ‘dieses Jahr
/diesjahr‘, düüskiehr /düüs Kiehr ‘diesmal; wörtl.: dieskehr, diese Kehre‘, düüs Tuur ‘diesmal; wörtl.
diese Tour‘.
- Vgl. auch Kapitel 17. ↩
- Siehe hierzu auch Kapitel 4, vom Weglassen, und Kapitel 10 zum Adjektiv. ↩
- „sell II [...] aus selb, u. zwar sęl Rhfrk in Saarbr, Ottw, Nahe u. in bestimmten Wend. auch im Hunsr u. an der Mos Pron. demonstrat.: jener, seller jener, sell(i) jene, sell jenes u. der-, die-, das sell (das sell do); en seller Nacht; on sellen Da; die selle Zeide sen erom; die selle Bire sen all gess das ist vorbei, nicht wahr; so hat die sell Fra a (auch) gesat; of der sell Seit jenseits; das (dar) un sell dies u. jenes; der on seller, die on sell. — Sellmol u. es sellmols damals auch Saarl u. im obigen Geb., Simm, Wittl-Monzel; sellemol(s) häufiger in Saarbr, Ottw, Nahe u. Trier-Krettnich Mehring; selle dort Bernk-Bollenb; sellt dass. Meis-Bechert, Simm-Gemünden; selldə Simm. — Vor sell was das anbetrifft; ich hätt ach (auch) Hose krit vor zwelf, vor fofzeh Mark, vor sell Saarbr-Sulzb.“ (RHEIN. 8, 72). ↩
- Es heißt „bei Nichtkörpern stets dis Woch, dis (…) Johr, dis Kihr (Res, Tur) udgl.;“ (RHEIN. 1, 1357). ↩
- Vgl. hierzu auch Kapitel 17. ↩
15. Fragewörter
Ber, bat, bemm, benn, belsch und bee, bo, borümm, bésuu. Fragepronomen und Frageadverbien
Die Mayener Fragefürwörter haben sämtlich einen auffälligen b–Anlaut: ber, bat, bemm, benn, belje, belsch, beljet ‘wer, was, wem, wen, welcher, welche, welches‘. Sie werden nicht anders als die standardsprachlichen gebraucht. ‘Wessen‘ gehört nicht zu den Mayener Fragewörtern und wird durch bemm säine /säin / säi ‘wem sein /seine /sein‘ (possessiver Dativ) ersetzt, z. B. Bemm säine Kówwa és dat daa? Wörtl. ‘Wem seinen Koffer ist das dann?‘ Wie in vielen Dialekten wurde (wird?) auch in Mayen unangemessenes oder zu häufiges Fragen durch Scherzantworten oder derbe Antworten zurückgewiesen. So lautete Antwort auf die Frage: Ber? ‘Wer?‘: „[D]e Mann von Wehr“ (RHEIN. 9, 430). Wenn e kümmt, dann schécks d’en her! Nach WALTER FISCHER gab es auf die Frage: Ber wòr dat? Aaschplòòse Jakob! zur Antwort.
Wie die Fragepronomen, beginnen die meisten der Mayener Frageadverbien mit ‘b‘: bee, bo, borümm, bésuu, bofür, boher, bohin, bojään ‘wie, wo, warum, wieso, wofür, woher, wohin, wo(hin)gegen‘, aber nicht alle, so z. B. ‘wann‘ wann, ‘weshalb‘ weshalf und weswääje ‘weswegen‘. Statt mit ‘warum‘ fragt man auch gern mit mit weshalf, das nicht im Rheinischen Wörterbuch verzeichnet ist, und weswääje und häufig auch mit bofür ‘wofür‘, das laut DUDEN bedeutet, „für welche Sache“, ‘für was wird etwas benötigt‘, nach dem Grund: Weshalf, weswääje, bofür dat daa? Auf Borümm? ‘warum, wörtl. worum‘, folgte früher nicht selten, um die neugierige Frage zurückzuweisen: Üm de Krümm! ‘Um die Krümmung‘, d. h. ‘Biegung, Kurve‘ – ein Wortspiel, bei dem borümm absichtlich in der Bedeutung ‘wo(her)um‘ missverstanden wird. Bohin meint einfach nur die Frage nach dem Wohin, aber boher meint zwar auch ‘woher‘, außerdem aber ‘warum, inwiefern‘, etwa Boher dat daa? ‘Inwiefern ist das so?‘ Und als Antwort auf z. B. Gehst du dort hin? Bedeutet Boher dann! evtl. zusätzlich mit wegwerfender Handbewegung ‘Mitnichten, keinesfalls!‘ Die Kombination von bohin ón bóher hat eine eigene Bedeutung: Ésch wósst nimmieh bohin ón boher! ‘Ich wusste nicht mehr ein noch aus (wörtl. ich wusste nicht mehr wohin und woher)!‘
Viele dieser zusammengesetzten Adverbien werden normalerweise „auseinandergenommen“, d. h. geteilt: Bo jahsde daa hin? ‘Wo gehst du denn hin?‘ statt Bohin jahsde? und Bo küssde daa her? ‘Wo kommst du denn her? statt Boher küssde? Bo bésde daa jään jerannt? ‘Wörtl.: Wo bist du denn gegen gerannt (=gestoßen)?‘ statt Bojään bésde jerannt? Das trifft auch auf die zahlreichen Frageadverbien zu, die im Mayener Platt zusätzlich ein t haben, etwa botran 1. ‘woran‘. – 2. ‘an was daran, befestigt‘, z. B. Bo merkt ma dat daa tran? ‘Woran merkt man das denn?‘ und Bo és dat tran? ‘An was ist es befestigt? Wörtl.: Wo ist das daran?‘, botróff 1. ‘worauf‘. – 2. ‘auf was drauf (lokal)‘, z. B. Bo hadden dat daa tróff jesòòt? ‘Worauf hat er das denn gesagt?‘ und Bo staht dat daa tróff? ‘Worauf steht das denn?‘ oder auch: ‘Wo steht das (geschrieben)?‘ , botrénn ‘worin‘, Bo és dat trénn? ‘Worin befindet es sich?‘, botraus ‘woraus‘, Bo és dat traus jemaacht? ‘Woraus ist es gemacht?‘, botrüwer: 1. ‘worüber‘. – 2. ‘über was (lokal)‘, z. B. Bo hasde désch daa suu trüwer jeärjert? ‘Worüber hast du dich denn so geärgert?‘ und Bo dahsde daa der Pullover trüwer? ‘Worüber trägst du denn den Pullover?‘, botrümm: 1. ‘worum, um was‘. – 2. ‘woherum, wodrum‘, z. B. Bo wette ma trümm? ‘Worum wetten wir?‘ und Bo missde der Schal trümm? ‘Wo machst du den Schal drum?‘ (nicht zu verwechseln mit borümm).
16. Artikel
Däa, dee, dat und aane, aan, aa. Doo der Mandel aus! Bestimmter und unbestimmter Artikel /Geschlechtswörter; Rheinischer Akkusativ
Auch die Formen der bestimmten und unbestimmten Artikel im Platt sind zahlreicher als in der Standardsprache, weil es auch hier volle und schwache gibt. Beim Neutrum hat sogar das Personalpronomen et Artikelfunktion übernommen. Die Formen des bestimmten Artikels im Platt lauten:
| SING. | Mask. | Fem. | Neut. | PLURAL |
|---|---|---|---|---|
| Nom. | der, dä | dee, de | dat, et | dee, de |
| Dat. | demm, em | der, da | demm, em | denne, de (da) |
| Akk. | denn, de (der) | dee, de | dat, et | dee, de |
Sofern nicht etwas besonders hervorgehoben werden soll, werden die schwachen Formen gebraucht: Dat és de Onggel /de Proder. ‘Das ist der Onkel /der Bruder.‘ Dat és de Erwin. ‘Das ist Erwin.‘ Dat és de Tant /de Schwesder. ‘Das ist die Tante /die Schwester.‘ Dat és et Eng-gelsche. ‘Das ist das Enkelkind (wörtl.: es Enkelchen).‘ Dat és et Chrisda. ‘Das ist Christa.‘ Dat säin de Kénner. ‘Das sind die Kinder.‘ Diese schwachen Formen stimmen mit den Artikeln des Niederländischen überein, das nur zwei grammatische Geschlechter kennt, de man / de vrouw und het meisje, und erinnern an die Verwandtschaft des Mayener Platts mit diesem. Werden statt der unbetonten Formen die Vollformen gewählt, ist das, sowohl bei Nominativ (der, dee, dat), Dativ (demm, der, demm) und Akkusativ (denn, dee, dat), eine Betonung, z. B. Ésch manen dee Kusiene ‘Ich meine die Kusinen.‘, oder Hervorhebung und verlangt eine Erläuterung, die positiv, neutral oder negativ sein kann: Der Peder, der én mäiner Klass wòr. Dee Frau, dee nääwer Schüllersch wónnt. Dat Lissi, dat méddem W´öllm verhäiròòt és. Dee Leut, dee säin nét aus Maye. Im Dativ heißt es z. B. Dat Jeld hann ésch em Oba / em Günder / da Oma / da Mamma / em Heike jénn. ‘Das Geld habe ich Opa/ Günter / Oma / Mama / Heike gegeben.‘ Im Dativ-Plural, ziemlich konstruiert, aber möglich: Dat Jeld jénn ésch de arme Leut. ‘Das Geld gebe ich den armen Leuten.‘ Bei den vollen Dativformen heißt es: Breng dat Jeld demm Mann / demm Vadder /der Frau / der M´odder / demm Mädsche / denne Leut. ‘Bring das Geld dem Mann / dem Vater / der Frau / der Mutter / dem Mädchen /den Leuten (und nicht jemand anderem).‘ Im Akkusativ heißt es z. B. für die schwachen Formen: Ma besööjen de Oba / de Oma / et Tina / de Kruußellere. ‘Wir besuchen Opa /Oma / Tina / die Großeltern.‘ Beispiele für die Verwendung der starken Akkusativartikel sind: Roof morje denn Mann / dee Frau / dat Tina / dee Leut an. ‘Rufe morgen den Mann (d. h. jenen bestimmten Mann) / die Frau (d. h. jene bestimmte Frau) / Tina und nicht jemand anderes / die Leute (d. h. jene Leute) an.‘ Die vollen dialektalen Formen lassen sich nicht mit Vornamen und auch nicht z. B. mit Oma, Mama, Opa, Papa kombinieren, wenn nur eine neutrale Aussage ohne irgendeine Hervorhebung getroffen wird: *Dat Tina / *der Babba / *dee Mamma és dòò, standardsprachlich ‘Tina / Papa / Mama ist da‘.
Auch den unbestimmten Artikel gibt es jeweils in einer vollen und einer schwachen, reduzierten Form:
| SING. | Mask. | Fem. | Neut. |
|---|---|---|---|
| Nom. | aane, ene | aan, en | aa, e |
| Dat. | aanem, em | aaner, a | aanem, em |
| Akk. | aane, en | aan, en | aa, e |
Das Maskulinum hat die volle Form aane und die lautlich reduzierte Form en für den Nominativ und den Akkusativ. Wie beim Possessivpronomen gibt es auch hier den Formzusammenfall. Grammatisch gesehen ist die Nominativform ein Akkusativ: ‘einen‘: Dat és aane / en Mann. ‘Das ist einen(!) Mann‘. ‘Ein‘ heißt, wie die Neutrumsform zeigt, e. Die schwachen Formen von aane (m.) und aan (f.) entsprechen jeweils der ersten Silbe des standardsprachlichen ‘einen‘ und ‘eine‘- nicht der zweiten ‘*-nen‘, *-nen‘. Auch in der Mayener Umgangssprache heißt es nicht(!) ‘*-nen Mann‘, ‘*–ne Frau‘, sondern en Mann, en Frau. Die Endungen sind durch die Apokope weggefallen. Beim Neutrum ist nur ein e von ‘ein‘ geblieben. Am Kölschen kann man es erkennen: Dort heißt es ene Mann, en Frau, ene Besuch ém Zoo. Die Dativformen em ‘einem‘ sind wohl nur „zusammengezogen“ und sind formgleich mit ‘dem‘. Die feminine Form ‘einer‘ ist bis zum a reduziert und findet ihre Entsprechung bei der bestimmten Form für Dativ Fem. da ‘der‘.
Ein Beispiel für den Nominativ ist: En Mann / en Frau / e Kénd hat an da Düür jeklingelt. ‘Ein (wörtl.: einen) Mann / eine Frau / ein Kind hat an der Tür geklingelt.‘ Ein Beispiel für die schwache Dativform ist: Schenk dat Jeld em arme Mann / a arm Frau / em arme Kénd. ‘Schenk das Geld einem armen Mann / einer armen Frau /einem armen Kind.‘ Für den Akkusativartikel sind Ésch sehn en Mann / en Frau / e Kénd. ‘Ich sehe einen Mann / eine Frau / ein Kind.‘ Werden beim unbestimmten Artikel die vollen Formen gebraucht, „mutiert“ dieser zum Zahlwort ‘ein‘: Dat és aane Mann ‘Das ist ein (wörtl.: einen) Mann, also einer.‘, Dat és aan Frau. ‘Das ist eine (einzige) Frau‘, Dat és aa Kénd. ‘Das ist ein (einziges) Kind.‘, Lòh staht aane Stohl. ‘Dort steht ein (wörtl. einen) Stuhl‘ /aan Tass ‘eine Tasse‘, aa D´öbbe ‘ein Topf‘. Für den Dativ heißt es Dat jénnésch aanem Mann / aaner Frau / aanem Kénd. Beispiele für den Akkusativ sind: Ésch sehn aane Mann / aan Frau / aa Kénd. ‘Ich sehe einen einzigen/ einzelnen Mann / eine einzige /einzelne Frau / ein einziges /einzelnes Kind.‘
Doo denn aale Mandel aus. ‘Zieh (wörtl.: tu) den alten Mantel aus.‘ oder Doo der aal Mandel aus. wörtl.: ‘Zieh (wörtl.: tu) der alte Mantel aus.‘? Im Mayener Platt geht beides. Was in der Standardsprache gar nicht geht, ist im Mayener Platt möglich. Bei diesem sogenannten Rheinischen Akkusativ wird statt des Akkusativs (Wen-Fall) der Nominativ (Wer-Fall) verwendet. Er kann ausschließlich für das männliche Geschlecht gebildet werden, da es im Femininum, im Neutrum und im Plural im Platt keinerlei Unterschiede zwischen den Nominativ- und Akkusativformen der Artikel (dee und dat) gibt: Doo dee aal Bócks aus. ‘Tu (zieh) die alte Hose aus.‘ Doo dat aal Himm aus. ‘Tu (zieh) das alte Hemd aus.‘ Doo dee aale Schoh aus. ‘Tu (zieh) die alten Schuhe aus.‘
Es bedarf einer weiteren Voraussetzung zur Bildung des Rheinischen Akkusativs: Der schwachen Form de für ‘der‘ ist nicht anzusehen, ob sie Nominativ oder Akkusativ ist: Setz déof de Stohl. ‘Setz dich auf den /der Stuhl.‘ Gebildet werden kann der Rheinische Akkusativ nur mit der starken Form des Artikels, und zwar ausschließlich: Setz déof der Stohl lòh. wörtl. ‘Setz dich auf der Stuhl da.‘ Ésch ääsen der Abbl nét. wörtl.: ‘Ich esse der Apfel nicht.‘ Ésch wéll der Koore nét. wörtl. ‘Ich will der Kuchen nicht.‘ Der kennen ésch goot. ‘Der (= den Mann) kenne ich gut.‘ Ésch brauchen noch Kawwie. Hadda der? ‘Ich brauche noch Kaffee. Habt ihr der?‘ (Statt: habt ihr den). Preng ma aas der Schrübber. ‘Bring mir mal der Schrubber.‘ sind weitere Beispiele. Auch bei ‘keinen‘ kaaner, Ésch hann üüwer kaaner jet jesòòt. ‘Ich habe zu keinem etwas gesagt; wörtl.; Ich habe über keiner etwas gesagt.‘ und bei ‘einen‘ aaner, E hat aaner jesehn. ‘Er hat einer gesehen.‘ und bei ‘jeden‘ jeder: Ma hann jeder jefròòcht. ‘Wir haben jeder gefragt.‘ und „De Josep waaß mieh bee de Rob on de Peter. On de Franz on de Jab, de kennen doch jeder.“ wird der Rheinische Akkusativ verwendet.
Eine ähnliche Konstruktion gibt es im Mayener Platt auch beim Dativ-Plural, etwa: Jangk nét mét der Hänn én der Deisch. ‘Nimm deine Hände aus dem Teig; wörtl. Geh nicht mit der Hände in der Teig.‘ und Mét der Schóh kann ésch goot jòhn. ‘Mit der Schuhe kann ich gut gehen.‘ Ésch jénn der annere Leut dee Klader. ‘Ich gebe den anderen Leuten die Kleider.‘ wörtl.: ‘Ich gebe der anderen Leute die Kleider.‘ Pläif mét der treggéje Schoh ejause. ‘Bleib mit den dreckigen Schuhen draußen (wörtl.: hieraußen).‘ Statt dieser Konstruktion mit der Nominativform der ist die Dativform mit denne ‘den; wörtl.: denen‘ ebenso möglich: Ésch jénn denne annere Leut dee Klader.
- „es, et vertritt den Nom. u. Acc. des sächl. Artikels in unbetonter Stellung, während das, dat, dət als Artikel immer, wenn auch nur schwache demonstr. Nebenbed. hat [...]— Weibl. Vornamen haben es, et als Artikel, z. B. et Ann, et Marie, ob verheiratet oder nicht“ (RHEIN. 2, 177), und zwar ausschließlich und zwingend. Weitere Beispiele: Et Margret kuckt et Fisda raus. Wörtl.: ‘Es Margret guckt es Fenster raus.‘ De Tobias hängt et Bild óf. Wörtl.: ‘Tobias hängt es Bild auf.‘ Vgl. hierzu Kapitel 11 zum Personalpronomen der 3. Pers. Sg. Neutrum. ↩
- Die dä, z. B. im „Mayener Jung“ von VIKTOR KAIFER, wo es im Liedtext heißt „Dä Mayener schlaht ...“ (GEIERMANN 1978, 370), im Wenkerbogen von Mayen (10588) (Satz 4: „dä good ahl Mann“ und Satz 39: „dä braun Hond“) und dää, däa sind Schreibvarianten. ↩
- Vgl. auch Kapitel 11 Personalpronomen. ↩
- Vgl. hierzu Kapitel 12 zum Possessivpronomen der 3. Pers. Sg. mask. ↩
- Möglich auch (älter): der aal Mandel; vgl. hierzu auch Kapitel 10 zum Adjektiv, bes. zu den älteren ungebeugten Formen. ↩
- Aus „Rond üm de Maartbur.“ (Autor nicht feststellbar.) GEIERMANN 1978, 369. Im Original nicht kursiv. ↩
- Vgl. hierzu Kapitel 10 und 12. ↩
17. Präpositionen etc.
Zoo, bäi, für, üwer, vür ‘vor‘ ón vür ‘vorne‘. Dat säin ésch nét ze köhn! Et és für ze baschde! E jaht bäi de Dógder. Dat haddat üwer mésch jesòòt. Óf da Póljer Stròòß. Én da Maatstròòß. Jangk vür! Kuck vür désch! Wäil, wenn /wann, dat; wennsde, wäilsde; düüskihr, v´örrschjòhr; dò waaß ésch neust vón; häiunne, dòjään. Präpositionen, Konjunktionen und Adverbien
Präpositionen (Verhältniswörter), Konjunktionen (Bindewörter) und Adverbien (Beiwörter) sind kleine Wörter,
die nicht veränderbar sind.
Präpositionen, z. B. óf, zoo, én, nääver, die Wörter, die etwas zueinander in Beziehung setzen, hat das
Platt deutlich weniger als die Standardsprache. Auch in dieser kommen viele fast ausschließlich schriftlich
vor, etwa kraft und mittels. Die, die es im Platt gibt, haben z. T. zudem eine andere Funktion als in der
Standardsprache.
‘Zu‘ hat im Mayener Platt zwei Formen: zoo und ze. Echte Präpositionen im Sinne des DUDENs, mit denen die
Art und Weise, die Anzahl usw. von etwas gekennzeichnet wird, gibt es in Mayen nicht viele: ze Fooß ‘zu
Fuß‘, ze veert ‘zu viert‘, ze Präi schlòòn ‘zu Brei schlagen‘, zoo mäiner Zäit ‘zu meiner Zeit‘ zoo mäinem
Verknüüje ‘zu meinem Vergnügen‘. Die Form zoo wird gebraucht, wenn sie als Adjektiv, als Eigenschaftswort
eingesetzt wird: Dat Fisder és zoo. ‘geschlossen‘. Dadurch wird das Wort in Mayen veränderbar und bekommt
eine Endung: Ésch hätt jär zo-ene Schoh. ‘Ich hätte gerne geschlossene Schuhe.‘, E hat noch zo-ene Aure.
‘Er kriegt die Augen noch nicht auf.‘, Ma hann vür da zo-en Düür jestanne. ‘Wir haben vor der verschlossenen
Tür gestanden.‘ Weitere Beispiele für zoo sind: Se trääwen sésch aaf ón zoo. ‘Sie treffen sich ab und zu.‘,
Lòòß méaas en Moment häi sétze. Ésch mooß jerat zoo ma kumme. ‘Lass mich einen Moment hier sitzen. Ich
brauche eine Pause; wörtl.: Ich muss gerade zu mir kommen.‘
Auch bei Vorsilben von Verben ist es die volle Form: zookugge ‘zugucken‘, zoomaare ‘zumachen‘, zooschleese
‘zuschließen‘.
Ze nicht zoo ist es z. B. bei der Nennform des Tätigkeitsworts, die der DUDEN als Konjunktion wertet:
Wéllsde jet ze ääse oder ze tréngge? ‘Willst du etwas zu essen oder zu trinken?‘ Der hat ümmer jet ze
schänne. ‘Der /Er hat immer etwas zu schimpfen (wörtl. schänden).‘ E és für neust ze praure. ‘Er ist zu
nichts zu gebrauchen; wörtl.: Er ist für nichts zu brauchen.‘ Auch in dem folgenden (veralteten) Ausdruck
heißt es ze: Et jaht alles ze Schann. ‘Es geht alles kaputt; wörtl.: Es geht alles zu Schanden (sowohl
konkret als auch übertragen).‘ oder: Dee maaren alles ze Schann. ‘Sie bekommen alles kaputt; wörtl.: Die
machen alles zu Schanden.‘ Wenn ein „Zuviel“, eine zu große Zunahme von etwas angezeigt wird, heißt es ze:
Dat würd ma ze vill. Dat és ze kruuß / ze klaan / ze warm / ze deuer. Über den schönen Mayener Ausdruck Dat
säin ésch nét ze köhn! ‘Das trau ich mich nicht; wörtl.: Das bin ich nicht zu kühn!‘ wird sich gern lustig
gemacht.
‘Zu‘ wird auch mal wie in der Standardsprache mit Artikel verbunden, z. B. Et és zóm Heule, zóm Fottlauwe,
nét zóm Aushaale, zóm Schreie! Das Mayener Platt scheint aber ‘zum‘ nicht besonders zu mögen, denn es wird
häufig ersetzt:
‘Für + zu‘ für ze wird stattdessen z. B. in folgenden Beispielen gebraucht: Dat es für ze verzwäiwele, für
ze baschde, für ze laare. ‘Das ist doch für zu verweifeln, für zu bersten, für zu lachen.‘ Statt ‘zum‘
heißt es im Mayener Platt ‘für + zu‘ auch in folgenden Fällen: It hat kaa Zäit für ze bótze. ‘Es (=sie) hat
keine Zeit für zu putzen‘. Et és häi jénn vill ze warm für ze schlòòwe. ‘Es ist hier drinnen viel zu warm
für zu schlafen.‘ Ääß! Et és doch für ze ääse! ‘Iss (wörtl.: ess)! Es ist doch für zu essen!‘
‘Für + zu‘ sagt der Mayener ebenfalls statt ‘um + zu‘: Dau prauchs nét ze kumme für mésch aafzehólle. ‘Du
musst mich nicht abholen; wörtl.: Du brauchst nicht zu kommen, für mich abzuholen‘. Der hat kaa Jeld, für
én Urlaub ze fahre. ‘Er (wörtl.: der) hat kein Geld, für in Urlaub zu fahren.‘ Ésch wòr ze mööd, für noch
kauwe ze jòhn. ‘Ich war zu müde, für noch kaufen zu gehen‘.
Auch andere Kombinationen kommen vor: ‘für + in‘, Dat és jet für én de Sópp. ‘Das ist etwas für in die
Suppe.‘, und ‘für + nach‘, Der Wääsch és der besde für nòh Kürrmerésch.‘Der Weg ist der beste für nach
Kürrenberg.‘ (vgl. RHEIN. 2, 908), oder auch statt ums ‘für + es‘ für et, Für’t Fregge nét! ‘Ums Verrecken
nicht; wörtl.: Für es Frecken nicht!‘
‘Für‘ alleine heißt es in Häi dee Bócks wéll ésch für goot haale. ‘Diese Hose will ich für festliche
/offizielle usw. Anlässe reservieren; wörtl.: Hier die Hose will ich für gut halten.‘ und Dat finnen ésch
(nét) für goot. ‘Das finde ich (nicht) für gut.‘
‘Bei + Artikel‘ heißt es im Mayener Platt ausschließlich statt ‘zum‘ in den folgenden Fällen: Der Mayener
geht nie ‘zum Bäcker /zum Arzt /zum Aldi und zu(r) Oma‘. E jaht bäi de Bägger / bäi de Dógda / bäi de Aldi
ón bäi de Oma. ‘Er geht bei den Bäcker / ... / und bei die Oma.‘ Ón wenn en widderkumme és, dann wòr en
bäim Bägger / bäim Dógda / bäim Aldi ón óch bäi da Oma. ‘Und wenn er zurückgekommen (wörtl.: wiedergekommen)
ist, dann war er bei dem Bäcker / ... / und bei der Oma.‘ Er geht nicht mal ‘zum Auto‘, sondern an’t Audo
‘an es Auto‘. ‘Bei‘ wird auch statt ‘zu‘ in den folgenden Fällen gebraucht: Komm bäi mésch. (a) ‘Komm
hierher zu mir.‘ und (b) ‘Komm mich besuchen‘. E jaht bäi säine Freund. ‘Er geht bei seinen Freund.‘ It
jaht bäi säi Módder. ‘Sie geht zu ihrer Mutter; wörtl.: es geht zu seiner Mutter.‘
Auch ‘über‘ wird z. T. statt ‘zu’ gebraucht, ebbes üüwer aaner sòòn ‘zu einem etwas sagen; wörtl.: etwas über
einen sagen.‘ Däa hat jésda üüwer mésch jesòòt, ésch sääscht schlääscht aus. ‘Der hat gestern über mich
(= zu mir) gesagt, ich sehe schlecht aus.‘ It hat üüweren jesòòt, e s´öll at haam fahre. ‘Es hat über ihn
gesagt, er solle schon heim fahren.‘
Auf heißt es recht häufig an Stelle von ‘zu‘. Man ‘gratuliert jemanden auf den Namenstag‘, also Akkusativ:
Ésch kraddeleeren désch óf däine Namensdaach. ‘Ich gratuliere dich auf deinen Namenstag.‘ Hann se désch at
óf däine Jeburtsdaach kraddeleert? ‘Haben sie (=man) dich schon auf deinen Geburtstag gratuliert?‘ Ebenso
bekommt man Geschenke auf den Geburtstag und auf die Kommunion: Bat hasde daa óf de Jeburtsdaach/ óf de
Kommion krischt? ‘Was hast du denn auf den Geburtstag / auf die Kommunion (= Erstkommunion) gekriegt?‘ Der
Mayener geht auch nicht ‘zu‘ Veranstaltungen, sondern auf: Ma jinn óf de Kirmes / óf et Bórschfest / óf de
Lauksmaat / óf em Peder säin Hóchzäit. ‘Wörtl.: Wir gehen auf den [sic!] Kirmes / auf das Burgfest /auf den
Lukasmarkt / auf dem Peter seine Hochzeit.‘ Fröher säima óch óf de Hockeeball jange. ‘Früher sind wir auch
auf den Hockeyball gegangen.‘ Der Mayener jaht óf de Maat ón óf de Kérrjóf ‘geht auf den Markt und auf den
Kirchhof’. Wenn jemand im Weg steht, heißt es: Jangk aas óf Säit! ‘Geh mal auf Seite.‘ und wenn man zum
Vergnügen unterwegs ist, és ma óf Jück ‘ist man auf Jück‘. In Mayen geht man auch nicht zur Toilette,
sondern óf de Klo ‘auf den [!] Klo‘.
Nicht nur als Entsprechung von ‘zu‘ kommt auf vor: Dat Klaan ‘Das Klein (= die Kleine)‘, das seinem Vater
ähnlich ist, kütt janz óf säi Vadder raus ‘kommt ganz auf seinen Vater raus‘, auch in übertragener
Bedeutung. Auf heißt es auch in: E és schwer arsch óf säin Kénner. ‘Er ist vernarrt in seine Kinder; wörtl.:
er ist schwer arg auf seine Kinder‘.
Auf wird auch in der Bedeutung ‘an‘ verwendet, und man weiß noch genau: Dat wòr óf Usdere / óf Pingsde / óf
Wäihnachde / óf Chrésdaach / óf Meerdesdaach ón óf säinem Jeburtsdaach. ‘Das war auf Ostern / auf Pfingsten
/ auf Weihnachten / auf Christtag / auf Martinstag und auf seinem Geburtstag‘ und em zw´ölf Uhr óf de Kopp
hamma jääß / wòr Schluss ‘Punkt zwölf wurde gegessen / war Schluss. Wörtl.: um zwölf Uhr auf den Kopf haben
wir gegessen / war Schluss.‘ Bei Straßennamenangaben wird unterschieden zwischen ‘auf‘ und ‘in‘: Em Gerhard
säine Lade és óf da Kowelenzer Stròòß, Busenkells wòòren óf da Glaci, Schüllersch óf da Ringstròòß, Raabs
óf da St. Väit Stròòß. Diederéschs hann óf da Póljer Stròòß jewónnt ón et Ruthsche wónnt óf da Stehwésch.
Dagegen waren Maase én da Maatstròòß, Geiermanns én da Jöwelsjass, de Jénsderploom ém Endepudel, Pingsde én
da Kehréjer Stròòß und Schmidte én da Jerwerstròòß. Meistens sind es die Straßen, die aus der Stadt führen,
also in eine Landstraße übergehen, bei denen es óf heißt. Bei Straßen, die nur innerhalb der Stadt sind,
heißt es überwiegend én ‘in‘. Dies trifft aber nicht immer zu (Óf da Stehwésch ‘Auf der Stehbachstraße‘, Óf
em Schüwel „Auf dem Schüwel“ (Siegfriedstraße), Óf em Werth ‘Auf dem Werth‘). Möglicherweise ist die
Zuordnung heute auch weniger strikt.
Die Präposition ‘vor‘ gibt es örtlich und zeitlich. Zeitliches ‘vor‘ vür wird wie in der Standardsprache
gebraucht: Et és vierel vür träi. ‘Es ist viertel vor drei.‘ Vür wird in diesen Fällen immer mit Tonakzent
2 gesprochen [ˈfyː²ɑ]. Örtlich heißt es vür auch mit Tonakzent 2 [ˈfyː²ɑ], wenn es als Antwort auf ‘wo‘
gemeint ist: Dat läit vür da Dür. ‘Das liegt vor der Tür.‘ Jangk vür ma her. ‘Geh vor mir her.‘ (vgl.
RHEIN. 2, 909). Et staht vür däiner Naas! ‘Es steht vor deiner Nase!‘ Als Antwort auf ‘wohin‘, Kuck vür
désch, datsde nét fälls! ‘Sieh nach vorne, damit du nicht fällst. Wörtl.: Guck vor dich, dass du nicht
fällst.‘ (vgl. RHEIN. 2, 909) mit Tonakzent 1[ˈfy¹ɑ].
Auch mit Bindewörtern geht das Mayener Platt sparsam um. Es kennt davon wesentlich weniger als die
Standardsprache und der Gebrauch ist z.T. von ihr verschieden: Gegenüber ‘während‘ und ‘als‘ wird bee ‘wie‘
bevorzugt, z. B. Bee ésch haam johngt, hat et jeräänt. ‘Wie ich heim ging, hat es geregnet.‘ und Bee ésch
klaan wòr, hamma lòh jüwe jewónnt. ‘Wie ich klein war, haben wir dort drüben gewohnt.‘
Die Konjunktion ‘damit‘ „fehlt in der echten MA., dafür dat.“ (RHEIN. 1, 1207): Jangk haam, dats de nét nass
wüas. ‘Geh heim, dass du nicht nass wirst.‘ Schräiwet da óf, dats d’et nét verjiss! ‘Schreib es dir auf,
dass du es nicht vergisst.‘ Die Konjunktion denn gibt es ebenfalls nicht *Wir sind daheim geblieben, denn
das Wetter war schlecht. Stattdessen wird ‘weil‘ gebraucht: Ma säin dahaam pliewe, wäil et Wääder
schlääscht wòr. Zeitliches ‘wann oder wenn‘ kommt etwa vor in: Roof ma an, wannsde /wennsde dòò bés.
‘Ruf mir an, wenn du da bist.‘ Bedingendes wenn wird wie standardsprachlich gebraucht: Wenn ésch haam
kummen, mooß éjet üascht jet ääse. ‘Wenn ich heim komme, muss ich zuerst (wörtl.: es erst) etwas essen.‘
Oder: Naa! Ón wennsde désch óf de Kopp stells ón mét de Fööß „Hurra“ schreis!
Zwischen eine Konjunktion, z. B. wenn, wäil, dat, und das Personalpronomen dau / de, also bei der 2. Pers.
Sing., wird im Platt häufig ein s eingeschoben, so dass es im Mayener Platt wenns dau oder wenns de, wäils
dau oder wäils de und dats dau oder dats de heißt. Dasselbe geschieht auch bei Fragepronomen und
Frageadverbien, bee, bo, bat, bemm, bofür, borümm, weswääjen, so dass es dann bees dau / bees de, bos de,
bats de, bemms de, bofürs de, borümms de, weswääjens de u.a.m. Die Kombination Relativpronomen (der, dee,
dat) plus 2. Pers. Sing. (dau / de) bekommt auch ein s dersde, deesde, datsde. Das standardsprachliche
verstärkende ‘denn‘ gibt es nicht. Stattdessen steht dann: Bat s´öll dat daa? Bat wéllsde daa?
Die standardsprachlichen Zeitadverbien, dòhnòh ‘danach‘, jésder ‘gestern‘, ümmer ‘immer‘, morje ‘morgen‘,
sunndaas ‘sonntags‘, kennt das Mayener Platt ebenfalls. Es gibt aber einige weitere zusammengesetzte
Zeitadverbien bzw. Einwort-Zeitadverbien, nach dem Muster von düüsmòòl ‘diesmal‘, für die die
Standardsprache z. T. zwei oder drei Wörter braucht: Aus Pronomen plus Substantiv, mit Betonung auf düüs,
ist düüsjòhr ‘wörtl.: diesjahr‘ gebildet: De Simon jaht düüsjòhr én de Schull. ‘Simon wird dieses Jahr
eingeschult; wörtl.: geht diesjahr in die Schule‘, und Düüsjòhr jét et winnésch Küürje ‘Dieses Jahr gibt es
wenig Kirschen.‘ Ebenso ist düüskihr ‘diesmal; wörtlich: diese Kehre (= Kurve)’ zusammengesetzt: Düüskihr
passen éjaawer besser óf. ‘Diesmal passe ich aber besser auf; wörtl.: Dieskehr passe ich aber besser auf.‘
Aus Adjektiv plus Substantiv bestehen vürréschjòhr ‘voriges Jahr‘ (Et Jenny és at v´örrschjòhr métkumme.
‘Jenny ist schon voriges Jahr zur Erstkommunion gegangen; wörtl.: Es Jenny ist all vorigsjahr mitgekommen.
‘), nächstjòhr ‘nächstes Jahr‘ (Nächstjòhr fahre ma awer widder én Urlaub. ‘Nächstes Jahr fahren wir aber
wieder in Urlaub.‘), letztjòhr ‘vergangenes /voriges Jahr‘ (Letztjòhr hadden us nét besööscht. ‘Letztes
Jahr hat er uns nicht besucht.‘) Aus Präposition plus Zahlwort plus Substantiv ist vürzweijòhr
‘vorzweijahr’gebildet, wobei der Wortakzent auf zwei liegt: Ésch hann vürzweijòhr noch zehn Pónd mieh
jewòòcht. ‘Ich habe vor zwei Jahren noch zehn Pfund mehr gewogen.‘
Ebenfalls ungewöhnlich sind die Adverbbildungen seitelchens ‘sich seitwärts fortbewegen‘, z. B. Jangk
säidelsches, daa klappt dat schunns. ‘Geh seitwärts, dann klappt das schon.‘, bibbenfüßchens
(„hühnerfüßchens“) ‘lückenlos immer einen Fuß vor den andern setzend mit ganz kleinen Schritten gehen‘:
Bofür jahs dau daa bibbeföößjes? ‘Warum machst du denn so kleine Schritte? Wörtl.: Wofür gehst du dann
bibbenfüßchens?‘, per händchens ‘händchenhaltend‘ (z. B. Se kòòmden per hännsches dórsch de Póljer Stròòß.
‘Sie kamen händchenhaltend (wörtl.: per händchens) durch die Polcher Straße.‘ Präpositionaladverbien, die
auf etwas hinweisen, werden im Mayener Platt ebenso wie ihre zugehörigen Frageadverbien in der Regel
geteilt: dòònòh ‘danach‘ / bonòh ‘wonach‘ (Dò fròòren ésch neust nòh. ‘Da mache ich mir nichts draus.
Wörtl.: Da frage ich nichts nach.‘), dòvón ‘davon‘ (Dòò waaß ésch neust vón. ‘Da weiß ich nichts von.‘),
bovón ‘wovon‘ (Bo és de Reed vón? ‘Wo ist die Rede von?‘), dòfür / lòhfür (=alldafür) ‘dafür‘ (Dò / Lòh
kann ésch neust für. ‘Da kann ich nichts für.‘), bofür ‘wofür‘ (Bo prauchs de dat für? ‘Wo brauchst du das
für?), dòtrann/ lòhtrann (=alldadran) ‘daran‘ (Dò / Lòh säihs de dat doch trann! ‘Da siehst du das doch
dran.‘), botrann ‘woran‘ (Bo säihs de dat trann? ‘Wo siehst du das dran?‘), häi(e)rüwer ‘hier(her)über‘
(Häi jahdet erüwer! ‘Hier geht es rüber!‘) borüwer ‘worüber‘ (Bo jahdet rüwer? ‘Wo geht es rüber?‘),
häidórsch (örtl.) ‘hierdurch‘ / bodórsch ‘wodurch‘, häijään ‘hiergegen‘ / bojään ‘wogegen‘, häieróf
‘hierherauf‘ / bo(e)róf ‘woherauf‘, lòhtróf (= alldadrauf) ‘dadrauf‘, lòhtrénn (= alldadrin) ‘dadrin‘,
lòhtrüwer (=alldadrüber) ‘dadrüber‘ u.v.m.
Es ist aber nicht möglich, nach Gutdünken beliebig jedes Präpositionaladverb auseinanderzunehmen. Häiunne
‘hierunten‘, häijause ‘hieraußen (=draußen), dahaam ‘daheim‘, dòhénner ‘dahinter‘ (Dòhénner és em
Kruußvadder säine Jaade. ‘Dahinter ist Großvaters Garten.‘), dònäwer ‘daneben‘ (Dònääwer és de Supermarkt.),
dòhnòh ‘danach‘ (zeitlich) (Dònòh hann ésch kaa Zäit mieh. ‘Danach habe ich keine Zeit mehr.‘), häinòh
‘hiernach‘ (Häinòh mööse ma haam jòhn. ‘Hiernach müssen wir heim gehen.‘) z. B. lassen sich nicht spalten.
Bei anderen wird das Adverb noch einmal wiederholt, z. B. dòbei: Dò és doch neust dòbäi! ‘Da ist doch
nichts dabei! oder aber bobäi ‘wobei‘: Bo és neust dòbäi? und ebenso bei lòhbäi: Lòh és et nét dòbäi. ‘Da
ist es nicht dabei.‘ Auch dòjään ‘dagegen‘ lässt sich nicht auseinandernehmen: Wunderschön és Treck dòjään!
‘Es ist über die Maßen schön. Wörtl.: Wunderschön ist Dreck dagegen.) Beliebige „Verdopplungen“ sind auch
nicht möglich: Dò ... dòhnòh, lòh ... dòmét, häi ... dòmét sind nicht korrekt.
18. Hinweise zum Gebrauch
Hinweise zum Gebrauch des Wörterbuchteils: Aufbau des Wörterbuchartikels, Mayener Lautschrift, phonetische Transkription (IPA)
Für die Benutzung des Mayener Wörterbuchs sind die folgenden Erläuterungen hilfreich:
Der Stichwortansatz ist hochdeutsch, d. h., jòhn findet sich unter ‘gehen‘ und nicht unter jòhn. Bei
Substantiven ist das Stichwort in der Einzahl angegeben. Die Anordnung der Stichwörter ist alphabetisch.
Stichwörter, die keine hochdeutsche Entsprechung haben, werden nach Maßgabe des Rheinischen Wörterbuchs
ans Hochdeutsche angepasst. So findet sich etwa das Mayener Wort B´ösch (‘Wald‘) in der verhochdeutschten
Form unter dem Stichwort Büsch, Krómber ‘Kartoffel‘ unter Grundbirne. Wenn die verschriftete Form stark von der dialektalen abweicht (z. B.
Gehäugnis), wird zusätzlich eine dialektale Variante angeführt (Jeh´öschnis).
Ein Wörterbucheintrag gliedert sich in zwei Teile, den Artikelkopf und den Hauptteil. Zum Artikelkopf zählen
das Stichwort und die grammatischen Kategorien (Wortart, Genus (grammatische Geschlecht), Numerus (Einzahl,
Mehrzahl), Diminutiv (Verkleinerung). Den Hauptteil bilden die Lautformen, die Wortbedeutung(en), Verweise
und Beispiele.
Bei den Lautformen sind bei Substantiven Einzahl-, Mehrzahl und die Verkleinerungsform angegeben, bei
schwachen Verben der Infinitiv (die Nennform) und das Partizip Perfekt (das Mittelwort der Vergangenheit).
Starke Verben sind, soweit die Formen im Mayener Platt existieren, konjugiert, d. h., die einzelnen Formen
und die Zeiten sind angeführt. Die Darbietung der Aussprache geschieht dreifach: 1. akustisch (Anklicken
des Lautsprechersymbols), 2. in Populärumschrift („Mayener Lautschrift“) und 3. in phonetischer
Transkription entsprechend dem Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA).
Es folgen die Bedeutungserklärung und Verweise auf Synonyme (bedeutungsgleiche Wörter) und Wörter ähnlicher
Bedeutung im Wörterbuch sowie auf Quellen, in denen das betreffende Stichwort verzeichnet ist, und
verwandte Wörter. Den Abschluss bilden Anwendungsbeispiele in Populärumschrift, z. B. Dat és e bejierlésch
Deer! In den meisten Fällen schließt sich eine sinngemäße (‘Sie ist eine geizige Frau!‘) und eine wörtliche
Bedeutungswiedergabe (‘Das ist ein begierliches Tier!‘) an. Bei den Beispielen wird die Populärumschrift
z. T. stärker der Mayener Aussprache angenähert (z. B. Völga statt Völger ’Gesindel‘, Höötscha statt
Höötscher ‘Hütchen, Pl.‘).
Der Verdeutlichung dient diese schematische Darstellung:
Stichwort
grammatische Angaben
Aussprache im Mayener Platt
Internationale Lautschrift (IPA)
Bedeutung
Verweise auf Zusammensetzungen, bedeutungsähnl. Wörter, ähnl. Beispiele im Wörterbuch,
Beispiel auf Mayener Platt,
Bedeutungserklärung des Beispiels/wörtl. Übersetzung.
Und hier ein Beispiel:
Büsch
m. o. Pl. (= männlich ohne Plural /Mehrzahl)
B´ösch
[bøʃ]
'Wald'; Das Wort Wald gehört nicht zum
Mayener Platt.
Vgl. Büschbüschbutterramme, Büschlied.-
Ésch wòa én janz Stunn ém B´ösch spazeere.
Ich war eine ganze Stunde im Wald spazieren.
Mayener Hénnab´ösch.
"Mayener Hinterwald".
RW Dau leewa Gott ém B´ösch!
Ausdruck des Erstaunens, der Überraschung: Du meine Güte (wörtl. du lieber Gott im Büsch)!
Die Populärumschrift richtet sich nach der von RUDOLF POST für das Pfälzische aufgestellten Regel, die auch für das Mayener Platt ihre Gültigkeit hat: „Man halte sich, soweit es geht, an die Regeln der neuhochdeutschen Orthographie. Erst dann, wenn ein deutscher Leser, der des Pfälzischen nicht mächtig ist, durch diese Orthographie zu einer völlig falschen Aussprache verleitet würde, ist die Schreibung zu ändern.“ D. h., die Populärumschrift richtet sich in erster Linie nicht an den Mayener-Platt-Sprecher, der die Aussprache sowieso weiß, sondern ist als Hilfsmittel für Nicht-Mayener-Platt-Sprecher, die keine phonetischen Kenntnisse besitzen, gedacht. Die Stichwörter samt ihren verschiedenen Formen wurden zusätzlich in das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) transkribiert. Dies ermöglicht, das Mayener Wörterbuch zu Forschungszwecken zu nutzen.
a) Das Mayener Platt hat Vokale (Selbstlaute), die die Standardsprache nicht kennt, z. B. kurzes
geschlossenes ö, z. B. M´öck ‘Mücke‘, und langes offenes ö, z. B. S`ö`ösjes ‘Sößchens = Béchamelkartoffeln‘.
Mit dem normalen Buchstabeninventar lassen sich diese unterschiedlichen Laute nicht darstellen. Da sie
häufig bedeutungsunterscheidend sind, erfolgt, um falschen Aussprachen bei e, o und ö vorzubeugen, die
Kennzeichnung durch Akzente vor bzw. über dem betreffenden Laut: So heißt Pr`ö`öder mit Akzent ‘Bräter‘ und
Prööder ohne Akzent ‘Brüder‘ und Pl`ö`öt mit Akzent ‘Plätte, Platte, Glatze‘ und ohne Akzent plööt ‘blöd‘.
Ebenso werden Akzente bei o, z. B. Stroof ‘Strophe‘ und Stròòf ‘Strafe‘ und Hoor ‘Horn‘ und Hòòr ‘Haar‘
verwendet. Das kurze geschlossene Mayener o wird durch den Akzent ´ gekennzeichnet, z. B. Bócks ‘Buckse
(= Hose)‘. Auch beim e zeigt der Akzent ´ einen kurzen geschlossenen Laut an, etwa Béllere ‘Zahnfleisch,
Zahnleisten‘, Stésch ‘Stich‘.
Die Tonakzente (1 und 2) sind durch hochgestellte Ziffern (1), (²) gekennzeichnet. Die Längere Dauer von
Tonakzent 2 kann in der Populärumschrift nicht wiedergegeben werden.
b) Ein langer Vokal wird durch Doppelvokal (z. B. Baach – ‘Bach‘) wiedergegeben, es sei denn, in der hochdeutschen Entsprechung steht ein Dehnungszeichen, etwa h (sehn – ‘sehen‘) oder e (Pabier –‘ Papier‘). Die Schreibung mit einfachem Vokal würde eine falsche Aussprache bewirken.
c) Das –er am Wortende ist immer als volles [ɑ], zu sprechen, z. B. Binner [ɑ] ‘Ziege‘. Das Gleiche gilt für -r nach langem Vokal: Bier [ɑ] ‘Birne‘, Koor [ɑ] ‘Korn‘, Kòòr [ɑ] ‘Karre‘.
d) Die Konsonantenverbindungen st und sp werden im Anlaut und am Silbenanfang als scht, vor Konsonant: Strämbl ([ˈʃtʁɛ²mˑbl]) ‘Hühnerbein‘, bzw. schd vor Vokal: Stohl ([ʃdoː¹l]) ‘Stuhl‘ und als schp, vor Konsonant: Splénder ‘Splinter, Holzsplitter’, bzw. schb vor Vokal Spööl ([ˈʃbøː¹l]) ‘das zu spülende Geschirr‘ gesprochen. Auch in der Konsonantenverbindung -rst heißt es scht: Wuascht ‘Wurst‘, Büascht ‘Bürste‘. Ansonsten sind sie wie auch in der Standardsprache getrennt als s-t oder s-d, betr´öpst ‘betrübt‘, Fisder Fenster‘, Kasde ‘Kasten‘, und s-p oder s-b, Koppäinspolwer ‘Kopfschmerzpulver‘, Dunnerknésbel ‘verflixt‘ zu sprechen.
e) Das s, wie in Mussik ‘Musik‘und ss wie in Massick ‘Verrückter, Spinner‘ und Wasser, passe ‘passen‘, d. h. zwischen zwei Vokalen, wobei der erste kurz ist, ist immer stimmhaft zu sprechen s [z] [ˈmuzik], [ˈmazik], [ˈva¹zɑ], [ˈpazə]. Die Kürze des Vokals ist durch doppeltes ss angezeigt.
f) Die z. T. stimmhafte Aussprache von ‘sch‘ nach Vokal, z. B. wie wösche [ˈvœːʃə] ‘waschen‘ ist nicht
angezeigt.<
Die folgende Liste führt die verwendeten IPA-Zeichen (Spalte 1), die Buchstabenfolgen der Populärumschrift
(Spalte 2), Aussprachebeispiele aus der Standardsprache (Spalte 3) und Beispiele aus dem Mayener Platt in
Populärumschrift, in phonetischer Umschrift sowie die Bedeutungsangabe (Spalte 4) auf:
| Lautschrift (IPA) |
Populärumschrift | Aussprache | Beispiel |
|---|---|---|---|
| a | a | wie nhd. hat | bat [bat] 'was' |
| er | Wasser [vaza] 'Wasser' | ||
| ɑː | aa | wie nhd. Zahl | Baach [bɑː²x] 'Bach' |
| ah | fahre [ˈfɑː¹ʁə] 'fahren' | ||
| ai | ei | wie nhd. fein | Bohei [ˈbohɑi²] 'Aufhebens' |
| ai | Baijass [ˈbai¹jas] 'Clown' | ||
| au | au | wie nhd. Haut | Auch [au¹x] 'Auge' |
| b | b | wie nhd. Bau | bang [ba¹ŋ] 'bange' |
| d | d | wie nhd. dann | dau [dau²] 'du' |
| e | é | wie nhd. Methan | Kréffel [ˈkʁefəl] 'Griffel' |
| eː | ee | wie nhd. Beet | bedeene [bəˈdeː¹nə] 'bedienen' |
| eh | Lehrin [ˈleː¹ʁin] 'Lehrerin' | ||
| ɛ | ä | wie nhd. hätte | schännen [ˈʃɛ¹nə] 'schimpfen' |
| e | demmnòh [ˈdɛ¹mnɔː¹] 'demnach' | ||
| ɛː | äh | wie nhd. wähle | Nähdersch [ˈnɛː¹daʃ] 'Näherin' |
| ää | Prääml [ˈpʁɛː¹ml] 'Brombeere' | ||
| ɛi | äi | - | bäise [ˈbɛi²zə] 'beißen' |
| ə | e | wie nhd. halte | Òmend [ˈɔː¹mənt] 'Abend' |
| f | f | wie nhd. Fass | Fad(e)m [ˈfaː¹d(ə)m] 'Faden' |
| v | Vadder [ˈfada] 'Vater' | ||
| ff | Aff [af] 'Affe' | ||
| g | g | wie nhd. Gans | Äägel [ˈɛː¹gəl] 'Ekel' |
| h | h | wie nhd. hat | Hüht [hʏː¹t] 'Höhe' |
| i | i | wie nhd. vital | Itzik [ˈitsik] 'Spinner' |
| iː | ie | wie nhd. viel | iewésch [ˈiː¹veʃ] 'ewig' |
| j | j | wie nhd. ja | Jeck [jɛk] 'Geck' |
| k | k | wie nhd. kalt | beköbbe [bəˈkœbə] 'kapieren' |
| ck | Bócks [boks] 'Hose' | ||
| l | l | wie nhd. Last | elòh [əˈlɔː²] 'da, dort' |
| ll | pr´ölle [ˈpʁø¹lə] 'weinen' | ||
| m | m | wie nhd. man | ferm [fɛ²ʁəm] 'fest' |
| mm | Himm [hi¹m] 'Hemd' | ||
| n | n | wie nhd. Nest | Nést [nest] 'Nest' |
| nn | denne [ˈdɛ¹nə] 'denen' | ||
| ŋ | ng | wie nhd. lang | mengen [ˈmɛ¹ŋə] 'machen' |
| n | Kränkt [ˈkʁɛ²ŋˑkt] 'Krankheit' | ||
| o | o | wie nhd. Modell | Bohei [ˈbohai²] 'Aufhebens' |
| ó | óf [of] 'auf' | ||
| oː | o | wie nhd. Lot | Foß [foː¹s] 'Fuß' |
| oo | Koore [ˈkoː¹ʁə] 'Kuchen' | ||
| oh | Stallkoh [ˈʃdɑ²lˑkoː¹] 'Trampel' | ||
| ɔ | o | wie nhd. Post | fott [fɔt] 'fort' |
| ò | dòjään [dɔ¹ˈjɛː¹n] 'dagegen' | ||
| ɔː | òò | - | Òòzt [ɔː¹tst] 'Aas' |
| òh | Tròht [tʁɔː¹t] 'Draht' | ||
| ø | ´ö | wie nhd. Ökonom | Bösch [bøʃ] 'Wald' |
| øː | ö | wie nhd. mögen | Föß [føː¹s] 'Füße' |
| öh | föhle [ˈføː¹lə] 'fühlen' | ||
| öö | Jedööns [jəˈdøː¹ns] 'Getue' | ||
| œ | ö | wie nhd. könnt | beköbbe [bəˈkœbə] 'kapieren' |
| œː | `ö`ö | - | Str`ö`öm [ˈʃtʁœː¹m] 'Striemen' |
| œy | eu | - | däue [ˈdœy¹ə] 'drücken' |
| äu | kräule [ˈkʁœy¹lə] | ||
| p | p | wie nhd. Pakt | betr´öpst [bəˈtʁøpst] 'betrübt' |
| pp | Sch´öpp [ʃøp] 'Schaufel' | ||
| ʁ | r | wie nhd. Rast | Ròòs [ˈʁɔː¹s] 'Wut' |
| rr | Schnurres [ˈʃnu¹ʁəs] 'Schnurrbart' | ||
| s | s | wie nhd. Last | Bäus [ˈbœy¹s] 'Delle' |
| ss | Pless [plɛs] 'Blessur' | ||
| ß | S`ö`ößjes [zœː¹sjəs] Béchamelkartoffeln' | ||
| ʃ | sch | wie nhd. schal | Schrüpp [ˈʃʁyp] 'Prügel' |
| s | Speeks [ʃbeː¹ks] 'Spucke' | ||
| t | t | wie nhd. Tau | T`ösch [tœʃ] 'Tasche' |
| ts | z | wie nhd. Zelt | Zant [tsa²nˑt] 'Zahn' |
| ds | Perdsbunsel [ˈpɛɑtsbu²nˑzəl] 'Pferdeapfel' | ||
| tz | Dótz [dots] 'kleines Kind' | ||
| ts | kältse [ˈkɛ¹ltsə] 'Kälte verbreiten' | ||
| tʃ | tsch | wie nhd. Matsch | Praatsch [pʁɑː²tʃ] 'breit redende Frau' |
| u | u | - | Stuff [ʃduf] 'Stube' |
| uː | uu | wie nhd. Hut | Pruut [pʁuː¹t] 'Brot' |
| uh | Huhbaaner [ˈhuː¹bɑː¹nɑ] 'Weberknecht' | ||
| ui | ui | - | kuineere [kuiˈneː¹ʁə] 'quälen' |
| v | w | wie nhd. was | jüüwe [ˈjyː¹və] 'drüben' |
| v | Pólver [ˈpo¹ləvɑ] 'Pulver' | ||
| x | ch | wie nhd. Bach | Baach [bɑː²x] 'Bach' |
| yː | ü | wie nhd. Tüte | Büdsche [ˈbyː¹tʃə] 'Kiosk' |
| üü | büüs [ˈbyː¹s] 'böse' | ||
| üh | Hüht [hyː¹t] 'Höhe' | ||
| y | ü | wie nhd. füllt | atschüs [atˈʃʏs] 'tschüs' |
| z | s | wie nhd. Hase | Bäsem [ˈbɛː¹z(ə)m] 'Besen' |
| ss | Massik [ˈmɑ¹zik] 'Verrückter' | ||
| ː | Länge | ||
| ˈ | Hauptbetonung Nebenbetonung | ||
| ¹ | Tonakzent 1 | ||
| ² | Tonakzent 2 |
19. Konjugationstabellen
Konjugationstabellen
haben /hann
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | hann | hatt | hätt | hann jeha't | hatt jeha't etc. |
| dau | has | hatts | hätts | has jeha't | hatts jeha't |
| e | hat | hatt | hätt | hat jeha't | hatt jeha't |
| mir | hann | hadden | hädden | hann jeha't | hadden jeha't |
| ihr | ha't | hatt' | hätt' | ha't jeha't | hatt' jeha't |
| se | hann | hadden | hädden | hadden jeha't | hadden jeha't |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | weren hann | weren jeha't hann | hätt jeha't |
| dau | würs hann | würs j. hann | hätts jeha't |
| e | würd hann | würd j. hann | hätt jeha't |
| mir | weren hann | weren j. hann | hädden jeha't |
| ihr | wer't hann | wer't j. hann | hätt' jeha't |
| se | weren hann | weren j. hann | hädden jeha't |
sein /säin
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | säin | wòr | wär | säin jewääst | wòr jewääst |
| dau | bés | wòrs | wärs | bés jewääst | wòrs jewääst |
| e | és | wòr | wär | és jewääst | wòr jewääst |
| mir | säin | wòòren | wären | säin jewääst | wòren jewääst |
| ihr | säid | wòrt | wärt | säid jewääst | säid jewääst |
| se | säin | wòòren | wären | säin jewääst | se säin jewääst |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | Konj. II Fut. II Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | weren säin | weren jewääst säin | wär jewääst | wü¹r jewääst säin |
| dau | würs säin | wü²rs / wü¹rs j. säin | wärs jewääst | wü¹rs jewääst säin |
| e | würd säin | würd j. säin | wär jewääst | |
| mir | weren säin | weren j. säin | wären jewääst | |
| ihr | wer't säin | wer't j. säin | wärt jewääst | |
| se | weren säin | weren j. säin | wären jewääst |
werden /were
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Kon. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | weren | wur | wür | säin wure | wòr wure |
| dau | wü²rs | wurs | wü¹rs | bés wure | wòrs wure |
| e | würd | wur | wür | és wure | és wure |
| mir | weren | wuren | würen | säin wure | säin wure. |
| ihr | wer't | wurd' | wüürd' | säid wure | säid wure |
| se | weren | wuren | würen | säin wure | säin wure |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut.II Akt. | |
|---|---|---|
| ésch | weren were | weren wure säin |
| dau | wü²rs were | wü²rs wure säin |
| e | würd were | würd wure säin |
| mir | weren were | weren wure säin |
| ihr | wer't were | weer't wure säin |
| se | weren were | weren wure säin |
dürfen/dürwe
| Ind. Präs. | Ind. Prät. | Konj. II. Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | darf | durft | dürft | hann jedurft | hatt jedurft |
| dau | darfs | durf(t)s | dürf(t)s | has j. | hatts j. |
| e | darf | durft | dürft | hat j. | hatt j. |
| mir | dürwen | durfden | dürfden | hann j. | hadden j. |
| ihr | dürft | durft' | dürft' | ha't j. | hatt' j. |
| se | dürwen | durfden | dürfden | hann j. | hadden j. |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | Konj.II Fut. II Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | weren dürwe | weren jedurft hann | hätt jedurft | wü¹r j. hann |
| dau | wü²rs d. | wü²rs j. hann (wirst) | hätts j. | wü¹rs j. hann |
| e | würd d. | würd j. hann (wird) | hätt j. | wür j. hann |
| mir | weren d. | weren j. hann | hädden j. | würen j. hann |
| ihr | wer't d. | wer't j. hann | hätt' j. | wü¹r't j. hann |
| se | weren d. | weren j. hann | hädden j. | würen j. hann |
können / k´önne
| Ind. Präs. | Ind. Prät. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | kann | kónnt | k´önnt | hann jekónnt | hatt jekónnt |
| dau | kanns | kónn(t)s | k´önn(t)s | has j. | hatts j. |
| e | kann | kónnt | k´önnt | hat j. | hatt j. |
| mir | k´önnen | kónnden | k´önnden | hann j. | hadden j. |
| ihr | k´önnt | kónnt' | k´önnt | ha't j. | hatt' j. |
| se | kö´nnen | kónnden | k´önnden | hann j. | hadden j. |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | weren k´önne | weren jekónnt hann | hätt jekónnt |
| dau | wü²rs k´önne | wü²rs jekónnt hann | hätts jekónnt |
| e | würd k´önne | würd jekónnt hann | hätt jekónnt |
| mir | weren k´önne | weren jekónnt hann | hädden jekónnt |
| ihr | wer't k´önne | wer't jekónnt hann | hätt' jekónnt |
| se | weren k´önne | weren jekónnt hann | hädden jekónnt |
mögen /möje
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ungebräuchl.) | |||||
| ésch | maach | moocht | möscht | hann jemocht | hatt jemocht |
| dau | maachs | moochts | möschts | has jemocht | hatts jemocht |
| e | maach | moocht | möscht | hat jemocht | hatt' jemocht |
| mir | möjen | moochden | möschden | hann jemocht | hadden jemocht |
| ihr | mööscht | moocht' | möscht' | ha't jemocht | hatt' jemocht |
| se | möjen | moochden | möschden | hann jemocht | hadden jemocht |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | ---- | hätt jemocht | |
| dau | ---- | hätts jemocht | |
| e | ---- | hätt jemocht | |
| mir | ---- | hädden jemocht | |
| ihr | ---- | td>hätt' jemocht | |
| se | ---- | hädden jemocht |
müssen /mööse
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | mooß | mooßt | möößt | hann jemooßt | hatt jemooßt |
| dau | mooß | mooßt(s | möößt(s) | has jemooßt | hats jemooßt |
| e | mooß | mooßt | möößt | hat jemooßt | hatt hemooßt |
| mir | möösen | mooßden | möößden | hann jemooßt | hadden jemooßt |
| ihr | möö¹ßt | mooßt' | möö²ßt | ha't jemooßt | hatt' jemooßt |
| se | möö¹sen | mooßden | möö²ßden | hann jemooßt | hadden jemooßt |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | weren mööse | weren jemooßt hann | hätt jemooßt |
| dau | würs mööse | würs jemooßt hann | hätts jemooßt |
| e | würd mööse | würd jemooßt hann | hätt jemooßt |
| mir | weren mööse | weren jemooßt hann | hädden jemooßt |
| ihr | wer't mööse | wer't jemooßt hann | hätt jemooßt |
| se | weren mööse | weren jemooßt hann | hädden jemooßt |
sollen / sólle /s´ölle
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | sóll/s´öll/sall | sóllt | só²llt/s´ö²llt |
| dau | sólls/s´ölls/salls | sóllts | só²llts /s`ö²llts |
| e | sóll/s´öll/sall | sóllt | só²llt/s´ö²llt |
| mir | sóllen /s´öllen | sóllden | só²llden /s´ö²llden |
| ihr | só¹llt/ s´ö¹llt | só²llt | só²llt'/s´ö²llt' |
| se | sóllen /s´ö¹llen | só²llden/s´ö²llden | só²llden/s´ö²llden |
| Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | hann jesóllt | hatt jesóllt | hätt jesóllt |
| de | has jesóllt | hatts jesóllt | hätts jesóllt |
| e | hat jesóllt | hatt' jesóllt | hätt jesóllt |
| mir | hann jesóllt | hadden jesóllt | hädden jesóllt |
| ihr | ha't jesóllt | hatt' jesóllt | hätt jesóllt |
| se | hann jesóllt | hadden jesóllt | hädden jesóllt |
wollen / wólle /w´ölle
| Ind. Präs. | Ind. Prät. | Konj. II | Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | wéll | wóll(t) | w´öllt | hann jewóllt | |
| dau | wélls | wóll(t)s | w´öll(t)s | has jewóllt | |
| e | wéll | wó²ll(t) | w´öllt | hat jewóllt | |
| mir | wóllen/w´öllen | wóllden | wóllden/w´ö²llden | hann jewóllt | |
| ihr | wó¹llt/w´ö¹llt | wó²llt' | wó²llt'/w´ö²llt' | ha't jewóllt | |
| se | wóllen/w´ö¹llen | wóllden | wó²llden/w´ö²llden | hann jewóllt |
| Ind. Plusqu. Akt. | Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | hatt' jewóllt | weren wólle/ w`ölle | weren jewóllt hann | hätt jewóllt |
| de | hatts jewóllt | würs wólle /w´ölle | würs jewóllt hann | hätts jewóllt |
| e | hatt' jewóllt | würd wólle /w´ölle | würd jewóllt hann | hätt jewóllt |
| mir | hadden jewóllt | weren wólle /w´ölle | weren jewóllt hann | hädden jewóllt |
| ihr | hatt' jewóllt | wer't wólle /w´ölle | wer't jewóllt hann | hätt' jewóllt |
wissen/wösse (wésse)
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | waaß | wósst | w´össt | hann jewósst | hatt jewósst |
| dau | waaß | wóssts | w´össts | has jewósst | hatts jewósst |
| e | waaß | wósst | w´össt | hat jewósst | hatt' jewósst |
| mir | wössen | wóssden | w´össden | hann jewósst | hadden jewósst |
| ihr | wösst | wósst' | w´össt' | ha't jewósst | hatt' jewósst |
| se | wössen | wóssden | w´össden | hann jewósst | hadden jewósst |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | weren w´össe | weren jewósst hann | hätt jewósst |
| de | würs w´össe | würs jewósst hann | hätts jewósst |
| e | würd w´össe | würd jewósst hann | hätt' jewósst |
| mir | weren w´össe | weren jewósst hann | hädden jewósst |
| ihr | wer't w´össe | wer't jewósst hann | hätt' jewósst |
| se | weren w´össe | weren jewósst hann | hädden jewósst |
geben / jénn
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | jénn | jòòf/jòòft (älter) | jääf(t) | hann jénn etc. |
| dau | jés | jòòf(t)s | jääf(t)s | |
| e | jét | jòòf /jòòft (älter) | jääf /jääft (älter) | |
| mir | jénn | jòòwen /jòòfden (ä.) | jääwen /jääfden | |
| ihr | jét | jòòft' | jääft' | |
| se | jénn | jòòwen / jòòfden (ä.) | jääwen /jääfden |
| Ind. Plusqu. Akt. | Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut.II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | Imp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | hatt jénn etc. | weren jénn etc. | weren jénn hann etc. | hätt jénn | jéff! |
| Jéfft / jééft! (ä.) |
gehen /jòhn
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | jinn | joong(t) /jee¹ng//jee²ngt | jööng(t) /jee²ngt |
| dau | jahs | joong(t)s/ jee¹ngs | jööng(t)s/ jee²ngs |
| e | jaht | joong(t)/ jeengt | jööng(t) / /jee²ngt |
| mir | jinn | joong(d)en/ jeeng(d)en | jööng(d)en /jeengden |
| ihr | jiht | joongt/ jeengt | jööngt/ jeengt |
| se | jinn | joong(d)en/ jeeng(d)en | jööng(d)en/ jeeng(d)en |
| Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | säin jange etc. | wòr jange etc. | weren jòhn etc. | weren jange säin |
| Konj. II Plusqu. Akt. | Imp. | |
|---|---|---|
| ésch | wär jange | Jangk! |
| Jiht! |
schlagen /schlòòn
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | schlinn | schlooch | schlöö¹sch /schlöö²schd | hann jeschlòòn |
| dau | schlahs | schloochs | schlöö¹schs/schlöö²schden | has jeschlòòn |
| e | schlaht | schlooch | schlöö¹sch /schlöö²schd | hat jeschlòòn |
| mir | schlinn | schlooren | schlöö¹jen /schlöö²schden | hann jeschlòòn |
| ihr | schliht | schloocht | schlöö¹schd/schlöö²schd | hatt' jeschlòòn |
| se | schlinn | schlooren | schlöö¹jen/schlöö²schden | hann jeschlòòn |
| Ind. Plusqu. Akt. | Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | hatt jeschlòòn | weren schlòòn | weren jeschlòòn hann |
| dau | hatts jeschlòòn | würs schlòòn | würs jeschlòòn hann |
| e | hatt jeschlòòn | würd schlòòn | würd jeschlòòn hann |
| mir | hadden jeschlòòn | weren schlòòn | weren jeschlòòn hann |
| ihr | hatt jeschlòòn | weer't schlòòn | weer't jeschlòòn hann |
| se | hadden jeschlòòn | weren schlòòn | weren jeschlòòn hann |
| Konj. II Plusqu. Akt. | Imp. | |
|---|---|---|
| ésch | hätt jeschlòòn | schlaach! |
| schliht! |
lassen /lòòse
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | lòòsen | leeß | lee¹ß /lee²ßt | hann jelòòßt etc. |
| dau | l`ö`öß | leeß(ts) | dau lee¹ß/lee²ßts | |
| e | l`ö`ößt | leeß(t) | e lee¹ß/lee²ßt | |
| mir | lòòsen | leesen | mir lee¹sen/lee²ßden | |
| ihr | lòòßt | leeßt | ihr lee¹ßt'/lee²ßt' | |
| se | lòòsen | leesen | se lee¹sen/lee²ßden |
| Ind. Plusqu. Akt. | Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | Imp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | hatt jelòòßt | weren lòòse | weren jelòòßt hann | hätt jelòòßt | lòòß! |
| de | hatt's jelòòßt | lòòßt! | |||
| e | hatt' jelòòßt | ||||
| mir | hadden jelòòßt | ||||
| ihr | hatt' jelòòßt | ||||
| se | hadden jelòòßt |
kommen /kumme
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | kummen | kòò¹m/kòò²mt | kää¹m/kää²mt | säin kumme |
| dau | kümms/küss | kòò¹ms/kòò²mts | kää¹ms/kää²ms | bés kumme |
| e | kümmt/kütt | kòò¹m | kää¹m/kää²mt | és kumme |
| mir | kummen | kòò¹men/kòò²mden | kää¹men/kää²mden | säin kumme |
| ihr | kummt | kòò¹mt /kòò²mt | kää¹mt /kää²mt | säid kumme |
| se | kummen | kòò¹men/kòò²mden | kää¹men/kää²mden | säin kumme |
| Ind. Plusqu. Akt. | Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | wòr kumme | weren kumme | weren kumme säin | wär kumme |
| dau | wòrs kumme | würs kumme | ||
| e | wòr kumme | wür kumme | ||
| mir | wòren kumme | weren kumme | ||
| ihr | wòrt kumme | wer't kumme | ||
| se | wòren kumme | weren kumme |
| Imp. |
|---|
| komm/kumm! |
| kummt! |
stehen /stòhn
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | |
|---|---|---|---|
| ésch | stinn | stoong(t)/steeng/stónt/stunt | stööng(t)/steengt |
| dau | stahs | stoongs/steengs/stónts/stunts | stööngs/steengs? |
| e | staht | stoong/steeng/stónt/stunt | stööng(t)/steeng? |
| mir | stinn | stoong(d)en/steengen/stónden/stunden | stöng(d)en/steengen? |
| ihr | stiht | stoong(t)/steengt/stónt/stunt | stöngt/steengt |
| se | stinn | stoong(d)en/steengen/stónden/stunden | stööng(d)en/steengen |
| Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | hann jestanne | hatt jestanne | weren stòhn | weren jestanne hann |
| Konj. II Plusqu. Akt. | Imp. | |
|---|---|---|
| ésch | hätt jestanne | stand! |
| stiht! |
tun / doon
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ésch | doon | dòòt | däät | hann jedoon etc. | hatt jedoon |
| dau | daas | dòòts | dääts | ||
| e | daat | dòòt | däät | ||
| mir | doon | dòòden | dääden | ||
| ihr | doot | dòòt' | däät | ||
| se | doon | dòòden | dääden |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | Imp. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | weren doon | weren jedoon hann | hätt jedoon | doo! |
| dau | würs doon | würs jedoon hann | hätts jedoon | doot! |
| e | würd doon | würd jedoon hann | hätt jedoon | |
| mir | weren doon | weren jedoon hann | hädden jedoon | |
| ihr | wer't doon | wer't jedoon hann | hätt' jedoon | |
| se | weren doon | weren jedoon hann | hädden jedoon |
machen / maare
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | maaren | meesch /mooch | meesch(t) | hann jemaacht |
| dau | mischs /miss | meeschs /moochs | meesch(t)s | |
| e | mischt | meesch/mooch | meesch(t) | |
| mir | maaren | meejen/mooren??? | meejen | |
| ihr | maacht | meescht | meesch(t) | |
| se | maaren | meejen/ meeschden | meejen |
| Ind. Plusqu. Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | Imp. | |
|---|---|---|---|
| ésch | hatt jemacht | hätt jemaacht | maach! |
| maacht! |
sagen/ sòòn
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | sòòn | soot | hann jesòòt | hatt jesòòt |
| dau | s`ö`ös | sòòts | ||
| e | s`ö`öt | sòòt | ||
| mir | sòòn | sòòden | ||
| ihr | sòòt | sòòt' | ||
| se | sòòn | sòòden |
| Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | Imp. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | weren sòòn | weren jesòòt hann | hätt jesòòt | sòò! |
| sòòt! |
kriegen / kreen
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Prät. Akt. | Konj. II Prät. Akt. | Ind. Perf. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | kreen | kròòcht | krääscht | hann krischt |
| dau | kriss | kròòch(t)s | krääsch(t)s | |
| e | krischt | kròòcht | krääscht | |
| mir | kreen | kròòchden | krääschden | |
| ihr | kreescht | kròòcht' | krääscht | |
| se | kreen | kròòchden | krääschden |
| Ind. Plusqu. Akt. | Ind. Fut. I Akt. | Ind. Fut. II Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | hatt krischt | weren kreen | weren krischt hann | hätt krischt |
holen / hólle
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | hóllen | hann jehólt | hatt jehóllt | hätt jehóllt |
| dau | h´ölls | |||
| e | h´öllt | |||
| mir | hóllen | |||
| ihr | hóllt | |||
| se | hóllen |
| Imp. | Hóll! | Hóllt! |
|---|
kaufen /kauwe
| Ind. Präs. Akt. | Ind. Perf. Akt. | Ind. Plusqu. Akt. | Konj. II Plusqu. Akt. | |
|---|---|---|---|---|
| ésch | kauwen | hann kauft | hatt kauft | hätt kauft |
| dau | käufs | |||
| e | käuft | |||
| mir | kauwen | |||
| ihr | kauft | |||
| se | kauwen |
| Imp. |
|---|
| kauf! |
| kauft! |
20. Arbeiten zum Mayener Platt
Untersuchungen, Arbeiten und Veröffentlichungen zum Mayener Platt
Die älteste speziell das Mayener Platt behandelnde Veröffentlichung ist eine kleine zwanzig Seiten
umfassende Druckschrift zur Grammatik des Mayener Platts stammt aus dem Jahr 1910. Sie trägt den Titel
„Die hauptsächlichsten [sic!] Abweichungen der Mayener Mundart von der hochdeutschen Schriftsprache in
Wortbiegung und Satzbau“. Sie ist, wie auf dem Deckblatt handschriftlich vermerkt ist, „zusammengestellt
von Zenner – Einig, [Joseph] Hilger – Mayen, Montabaur – Thür, Weidenbach – Andernach.“ Relativ ausführlich
wird die Flexion der verschiedenen Wortarten behandelt, der sich eine knappe Darstellung zur Syntax
anschließt. Die Zusammenfassung von Formen verschiedener Ortsdialekte hat zur Folge, dass auch solche
aufgeführt werden, die für Mayen nicht gelten.
Eine kleine Sammlung Mayener Wörter von WALTER FISCHER (in Kurrentschrift) befindet sich im Archiv des
Geschichts- und Altertumsvereins Mayen: „[H]s. [handschriftliches; G. D.-S.] Wörterbuch mit Verzeichnis
des Mayener Sprachschatzes und dessen hochdeutsche Übertragung“. Es enthält viele heute nicht mehr
gebräuchliche Begriffe. 2018 wurde es veröffentlicht unter dem Titel: FISCHER, WALTER: Offjeschriewe.
Wöata, Red on Sprüch en da Mayener Sprooch. (Hrsg: Geschichts-& Altertumsverein für Mayen und Umgebung e.V.
Mundartinitiative).
REINHOLD SPITZLEI (am 28. 12. 2018 verstorben) hat zu den Themen „Mayener Schimpfwörter“ (1993) und
„Mayener Franzüsesch“ (1994) sowie „Mayener Antiquitäten“ (1987/1994), d. h. Anekdoten, Bücher
veröffentlicht. Seit 2013 liegt mir auch eine umfangreiche Sammlung zum Wortschatz vor, die der
Geschichts-& Altertumsverein Mayen mir als Kopie (unveröffentlichtes Manuskript) überlassen hat.
Inzwischen (2019) wurde es vom Geschichts- & Altertumsverein für Mayen und Umgebung e.V. herausgegeben:
SPITZLEI, REINHOLD: Mayener Wortschatz 1.0. Eine Sammlung der Mayener Mundart.
Bei verschiedenen großräumig angelegten wissenschaftlichen Erhebungen und Studien zu speziellen
sprachwissenschaftlichen Fragestellungen wurde das Mayener Platt mitbehandelt. Die wichtigsten Arbeiten
werden im Folgenden vorgestellt:
Die älteste Dokumentation, die auch das Mayener Platts umfasst, hat der Dialektologe GEORG WENKER
(1852 – 1911) durchgeführt. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Großprojekts, dessen Zweck die lautliche
Erfassung der Dialekte und die Ermittlung ihrer jeweiligen Grenzen war, hat GEORG WENKER durch indirekte
Befragung zuerst die Dialekte des Rheinlands, später sämtliche Dialekte des damaligen deutschen Reichs
erhoben und auf deren Grundlage den ersten Dialektatlas der Welt geschaffen („Sprachatlas der Rheinprovinz
nördlich der Mosel und des Kreises Siegen“ 1878“), der später zu dem bis heute weltweit umfangsreichsten
Dialektatlas erweitert wurde („Georg Wenkers Sprachatlas des deutschen Reichs, 1887-1923“ = Wenker-Atlas).
Der Atlas ist auf der Internetplattform „Regionalsprache.de“ zugänglich.
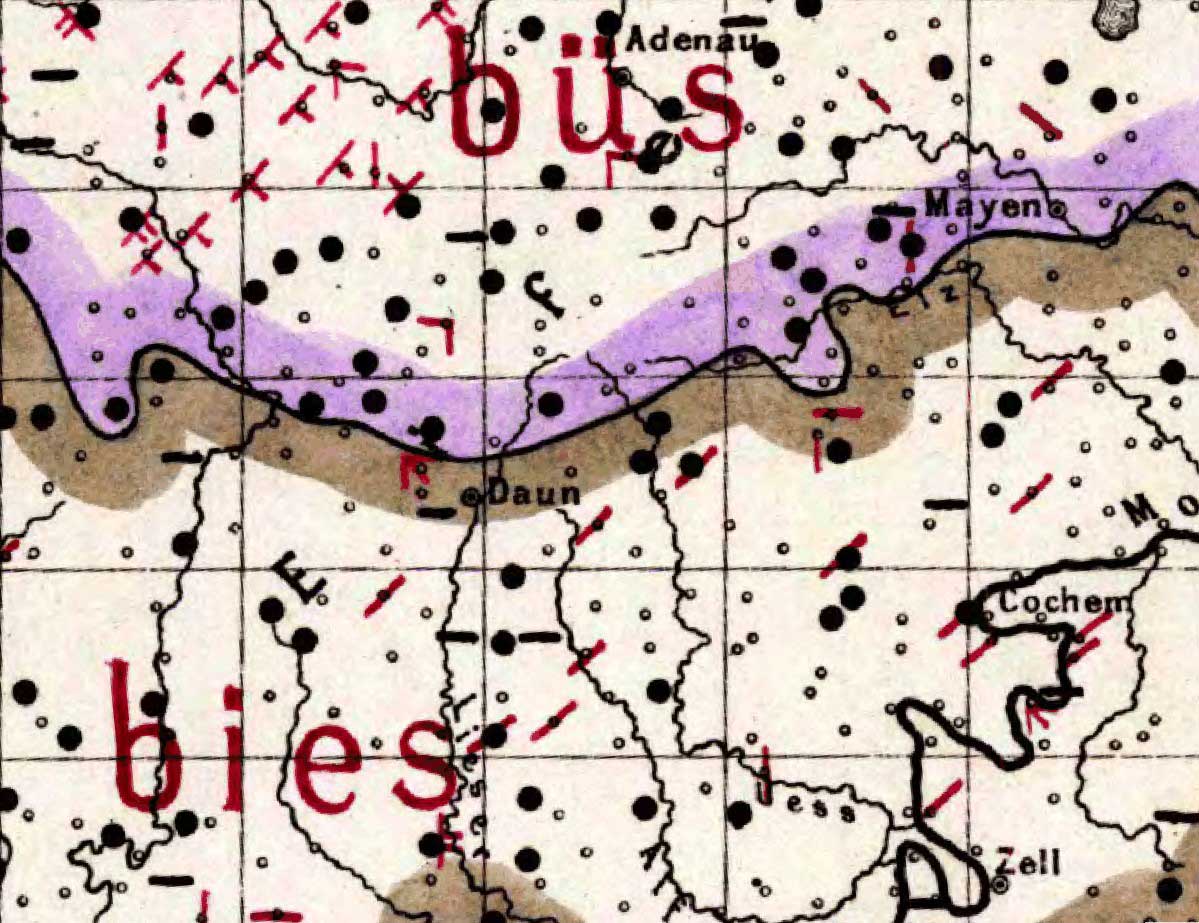
Ausschnitt aus der Karte „bösen“ im Wenker-Atlas (Abfragekontext: „Die bösen Gänse beißen dich tot.“)
Zur Erhebung der Dialekte wurden ca. 1500 Fragebogen mit 42 „volksthümlichen“ Sätzen in die Schulorte des Rheinlands verschickt, elf Jahre danach 38 bzw. 40 etwas modifizierte Sätze in alle Schulorte des gesamten deutschen Reichs, die von den Lehrern oder Schülern mit Hilfe des normalen Buchstabeninventars in die Aussprache des Ortsdialekts übertragen wurden. Da Mayen sowohl bei der rheinischen als auch bei der Untersuchung für das gesamte deutsche Reich Erhebungsort war, gibt es zwei Fragebogen. Der Fragebogen von 1876 mit der Wenkerbogen-Katalog-Nr. 29483 wurde von Lehrer T. Schneider, geb. in Dattenberg bei Linz a. Rhein, mit Unterstützung der Schüler ausgefüllt. Der zweite Bogen mit der Nummer 10588 wurde von Lehrer Franz Bell (Geburtsort Mayen) selbst bearbeitet. Der zweite, der für Mayen korrektere Fragebogen ist im Folgenden abgebildet:
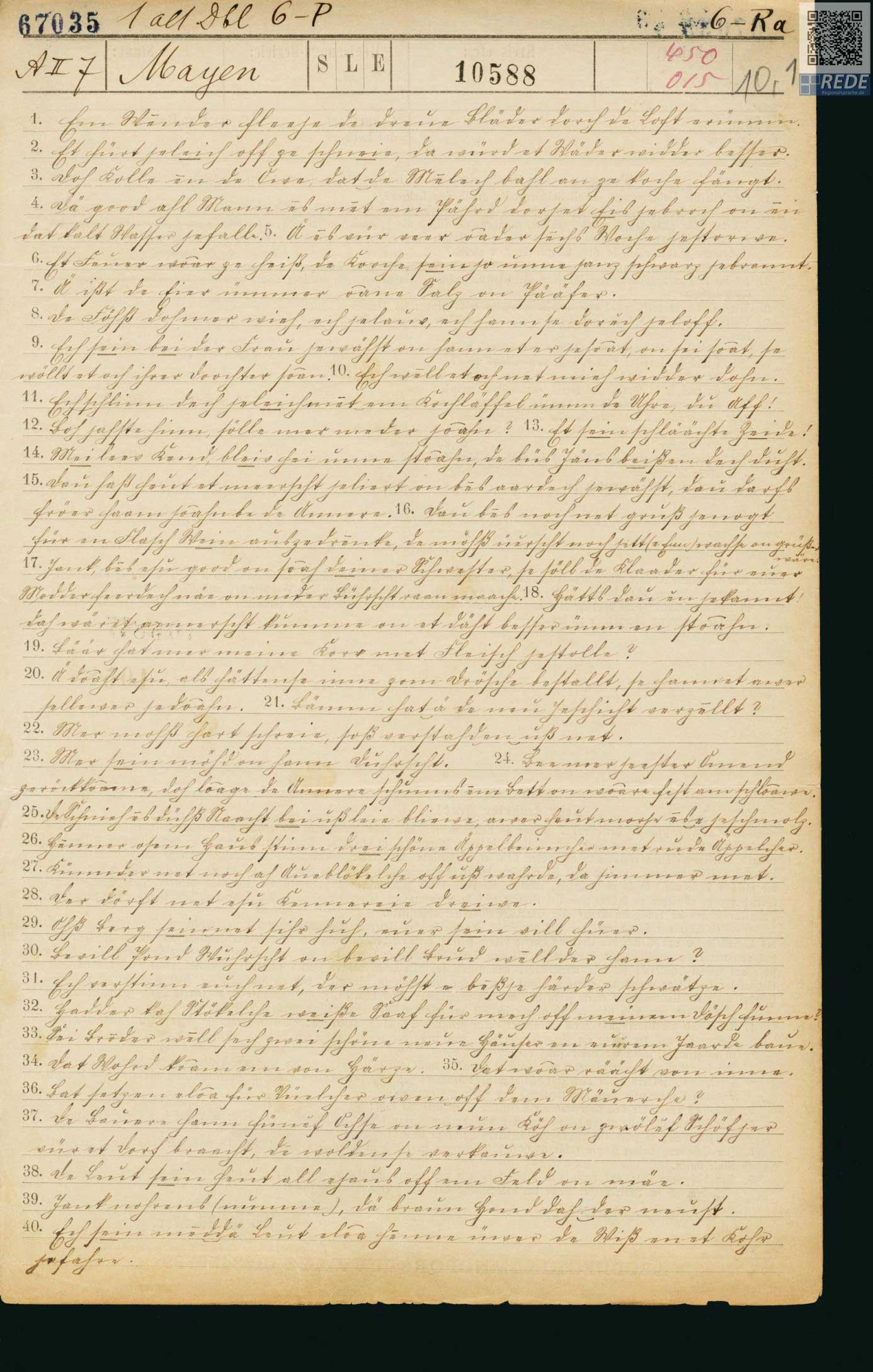
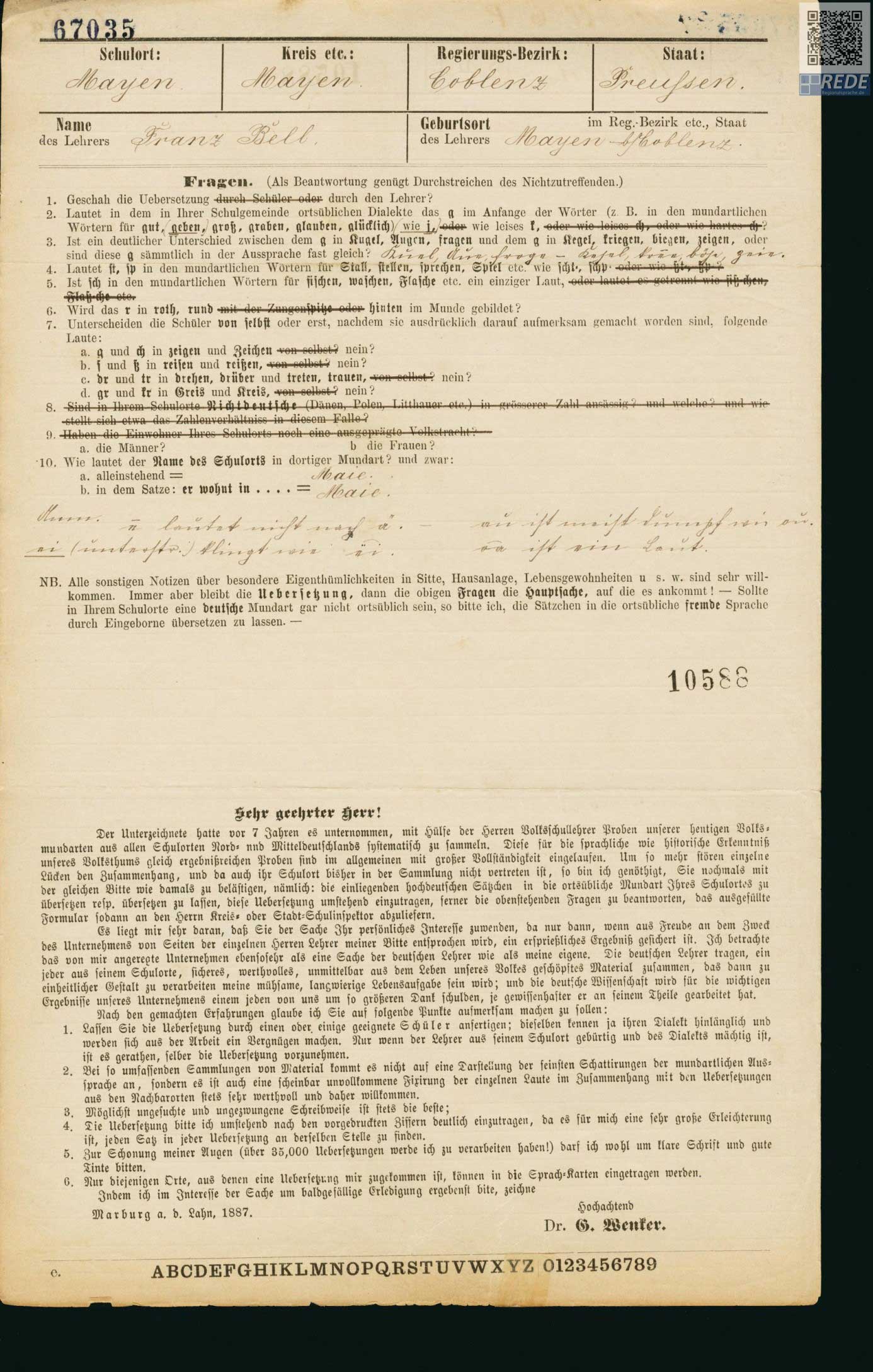
Das RHEINISCHE WÖRTERBUCH (RhWB = Rheinisches Wörterbuch. Bearb. und hrsg. von Josef Müller, ab Bd. VII von Karl Meisen, Heinrich Dittmaier und Matthias Zender. 9 Bde. Bonn und Berlin 1928–1971) (publiziert von 1928 bis 1971, hrsg. von MÜLLER/ DITTMAIER/ZENDER) ist ein neunbändiges Werk, von dem es inzwischen eine online-Version der Universität Trier gibt (https://www.woerterbuchnetz.de/RhWB), und „das umfangreichste Dialektwörterbuch des Westmitteldeutschen“. Es „enthält nun alle Wörter, wie sie im 19. Jahrhundert bis heute in der Mundart geläufig waren oder noch sind“. Als großlandschaftliches Wörterbuch, in dem das Stichwort auf Hochdeutsch angesetzt ist, verzeichnet es auch den Mayener Wortschatz. Da es aber die Verbreitung eines Wortes im ganzen Erhebungsgebiet dokumentiert, ist nicht für jedes Mayener Dialektwort auch Mayen explizit angeführt. Die zutreffende Form für das Mayener Wort Bäus ‘Beule‘ z. B. ist bei Bause zu finden. Schännen, das Mayener Wort für ‘schimpfen‘, ist im RHEINISCHEN WÖRTERBUCH 7, 907 unter dem Stichwort schänden eingetragen, aber auch hier ist Mayen als Belegort nicht genannt. Dagegen wird bei (an)gewegt kommen (RHEIN. 9, 501, 2 c: wiegen I) Mayen genannt: „angewegt kumme wiegend gehend May“.
Für das Projekt MITTELRHEINISCHER SPRACHATLAS (1994 – 2002) von GÜNTER BELLMANN, JOACHIM HERRGEN, JÜRGEN ERICH SCHMIDT war Mayen für die erste der beiden Aufnahmeserien ebenfalls Erhebungsort. Das fünfbändige Werk ist ein Laut- und Formenatlas für die Dialekte im linksrheinischen Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ziel dieses Unternehmens war unter anderem die Dokumentation des tiefsten Dialekts der zum damaligen Zeitpunkt über siebzig Jahre alten Dialektsprecher, die in dem betreffenden Ort geboren sind und ihr Leben lang auch dort gewohnt haben. Die Erhebung erfolgte den Vorgaben entsprechend bimedial. Das bedeutet, es wurden standardsprachliche Sätze bzw. Wörter anhand eines Fragebuches abgefragt, von den Informanten ins Platt übertragen und die Dialektsätze vom Explorator sofort in Lautschrift (IPA) im Fragebuch notiert. Zusätzlich wurde die Befragung durch Aufnahme mit einem Tonbandgerät festgehalten. Die Tonbandaufnahme für Mayen ist unter https://regionalsprache.de/Audio/Catalogue.aspx abrufbar. Dafür muss bei „Suchfelder“ als einziger Filter „Ort“ und als „Suchbegriff“ Mayen eingegeben werden. Der gedruckte Atlas ist in der Bibliothek des GAV vorhanden und im Internet ebenfalls unter „Regionalsprache.de“ zugänglich. Die Monographie „Die mittelfränkischen Tonakzente“ (Rheinische Akzentuierung) von JÜRGEN ERICH SCHMIDT (1986) bearbeitet das seit etwa 180 Jahren bekannte auffällige Phänomen des „Rheinischen Singens“. Die sprachlichen Merkmale, die das „Singen“ verursachen, betreffen nicht einen einzelnen Laut, sondern eine größere lautliche Einheit, nämlich die Silbe. Die bis dahin ungeklärte Erscheinung wurde grundlegend und wesentlich am Mayener Platt erforscht. Ziel war „eine Klärung zentraler Probleme der funktionellen, phonetischen und sprachgeographischen Beschreibung“ der Rheinischen Akzentuierung, d. h., der Zweck, die lautliche Seite und das Verbreitungsgebiet dieses Merkmals wurden untersucht.
Direkt zu Mayen liegt zudem eine Studie von KÜNZEL / SCHMIDT „Phonetische Probleme bei Tonakzent 1“ (2001) vor. Hierfür wurde mit Männern der freiwilligen Feuerwehr Mayen untersucht, welche Zusammenhänge zwischen Tonakzent und Satzintonation, speziell der Frageintonation, bestehen.
In der Monographie „Perzeptionsphonologische Grundlagen der Prosodie. Eine Analyse der mittelfränkischen Tonakzentdistinktion“ (2011) geht ALEXANDER WERTH der Frage nach, welche Merkmale für die Wahrnehmung der Mayener Tonakzente ausschlaggebend sind. Er konnte zeigen, dass für das Erkennen von Wortbedeutungsunterschieden ausschließlich der Tonhöhenverlauf in der zweiten Hälfte einer langen Silbe verantwortlich ist.
Das Mayener Platt ist zudem der erste deutsche Dialekt, für den die Lautverarbeitung neurolinguistisch mit Hilfe des EEGs untersucht wurde. Dort, wo die feineren Lautunterscheidungen des Mayener Vokalismus mit den gröberen der Standardsprache kollidieren, zeigen sich Sprachverarbeitungsreaktionen, die letzlich zu einem Abbau von Mayener Besonderheiten führen dürften.
Im Tonarchiv des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte, Bonn, findet sich eine längere Dialektaufnahme (Prosatext) für Mayen aus dem Jahr 1991. Der Text kann über http://rheinische-landeskunde.lvr.de>Sprache>sprechende Sprachkarte abgerufen werden.
- 1876 bis 1923. ↩
- Im Forschungsinstitut DEUTSCHER SPRACHATLAS in Marburg wurden nach den ins Platt übertragenen Sätzen der Fragebogen die Karten für den Atlas von Hand gezeichnet. Die Originalbogen und Atlaskarten befinden sich noch heute dort. Wenkersätze, Wenkerbogen und Wenkerkarten sind in digitalisierter Form unter https://www.regionalsprache.de/ einzusehen. ↩
- Wenkersätze, Wenkerbogen und Wenkerkarten sind inzwischen in digitalisierter Form unter https://Umgangs.de einzusehen. ↩
- dwv.uni-trier.de/de/die woerterbuecher/das-rh woerterbuchnetz.de, Vorwort, V. ↩
- SCHMIDT 1986, 4. ↩
- Vgl. Kapitel 6 und SCHMIDT 2016. ↩
21. Abkürzungen
Adj. Adjektiv / Wiewort / Eigenschaftswort
Adv. Adverb / Umstandswort
ä. älter
Akk. Akkusativ / Wenfall
Art. Artikel / Beiwort
ausgest. ausgestorben
bildl. bildlich
Dat. Dativ / Wemfall
Dat. Pl. Dativ Plural / Wemfall Mehrzahl
Demonstr.pron Demonstrativpronomen / hinweisendes Fürwort
Dim. Diminutiv / Verkleinerungsform
DWb Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
DWDS Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache
etc. et cetera / und so weiter
f. feminin / weiblich / die
Fragepron. Fragepronomen
Indefinit.pron. Indefinitpronomen / unbestimmtes Fürwort
Interj. Interjektion / Ausrufewort / Empfindungswort
Konjug. Konjugation / Beugung / Flexion eines Verbs
Konj. Konjunktion / Bindewort
Man. Manuskript [SPITZLEI]
m. maskulin / männlich / der
n. Neutrum / neutral / sächlich / das
Nom. Nominativ / Werfall
nhd. neuhochdeutsch
o. Art. ohne Artikel / ohne Beiwort
o. J. ohne Jahr [FISCHER]
o. Pl. ohne Plural / ohne Mehrzahl
Part. / V.PP Partizip / Mittelwort
Pers. Person
Pers.pron. Personalpronomen / persönliches Fürwort
PfWB Pfälzisches Wörterbuch
Pl. Plural / Mehrzahl
Poss.pron. Possessivpronomen / besitzanzeigendes Fürwort
Präp. Präposition / Verhältniswort
Prät. Präteritum / Imperfekt / Vergangenheitsform
Pron. Pronomen / Fürwort
Pronominaladv. Pronominaladverb
schw. schwaches Verb / Tunwort / Tätigkeitswort
st. starkes Verb / Tunwort / Tätigkeitswort
übertr. übertragen
refl. reflexiv / rückbezüglich
Reflexivpron. Reflexivpronomen /rückbezügliches Fürwort
RA Redensart
RW Redewendung
RHEIN. Rheinisches Wörterbuch
Sg. Singular / Einzahl
unbest. unbestimmt
unreg. unregelmäßiges Verb / Tunwort / Tätigkeitswort
Vgl. vergleiche
wörtl. wörtlich
22. Literatur
Wikipedia-Artikel zu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Moselfr%C3%A4nkische_Dialekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandhi
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Lautverschiebung
Wörterbücher
Sprachatlanten